Das nordische Riesenvolk der Frostriesen geht auf den Urriesen Ymir zurück. Aus einem Zweig dieses Riesenstamms entstand das Göttergeschlecht der Asen, dem auch der Gott Odin angehörte. Zwischen Göttern und Riesen herrschte Feindschaft und nach einem schrecklichen Kampf erschlugen die Asen ihren Urerzeuger Ymir. Dabei ertranken alle Riesen bis auf Bergelmer, dem mit seiner Frau die Flucht gelang, in den gewaltigen Mengen von Blut, die aus dem Leib des Urriesen flossen. Die beiden Riesen wurden die Eltern eines neuen Riesengeschlechts. Mit Ymirs Körper erschufen die Asen die Welt. In den Mittelpunkt der Welt setzten sie das Reich, in welchem die Menschen wohnen sollten. Dieses nannten sie Midgard und umgaben es zum Schutz vor den Riesen mit einem Gebirgswall, den sie aus Ymirs Augenbrauen bildeten. Aus zwei Baumstämmen machten die göttlichen Asen das erste Menschenpaar, Ask und Embla. Ihren eigenen Wohnsitz nahmen die Asen hoch über dem Reich der Menschen ein und gaben ihm den Namen Asgard. Die beiden Gefilde verbanden sie durch den Regenbogen Bifrost, auf welchem der Donnergott Thor mit seinem riesigen Streitwagen in Welt der Menschen gelangen und nach dem Rechten sehen konnte. |
| Eine Banshee (Frau der Feen) ist ein weiblicher Geist aus dem irisch-keltischen Sagenkreis. Es handelt sich um die Erscheinung einer totenbleichen Frau mit wirrem schwarzen Haar, deren Augen stets rot und geschwollen sind vom Weinen. Bekleidet ist sie mit einem grünen Kleid und einem grauen Umhang. Gewöhnlich bekommt man eine Banshee nicht zu Gesicht, sondern hört nur ihre entsetzlichen Schreie, die dem Heulen eines Wolfes oder den Schmerzensschreien einer gebärenden Frau gleichen. Zu jeder traditionellen schottischen oder irischen Familie gehört eine persönliche Todesfee. Wenn jemand aus der Familie ihr Heulen vernimmt, weiß er, daß diese damit vor dem nahenden Tod eines Familienmitglieds warnt. Mit ihrer Totenklage, verleiht die Banshee ihrer Trauer über den Verlust des sterbenden Menschen Ausdruck. Áine ist die Anführerin der Todesfeen, sie ist es auch, welche die Verstorbenen auf ihrem Weg in die Unterwelt begleitet. Ein Basilisk ist ein Ungeheuer, das in verschiedenen Gestalten überliefert ist: als gelbe Schlange, als Mischwesen aus Schlange, Hahn und Kröte oder als geflügelter Drache mit Hahnenkopf. Der Überlieferung nach wird ein Basilisk geboren, wenn das Ei eines Hahnes von einer Schlange oder einer Kröte ausgebrütet wird. Ein Blick aus den Augen dieser Kreatur genügt, um jedes Lebewesen in seiner Sichtweite sofort zu töten. Zudem besteht ein Basilisk aus Gift, jede Waffe, die mit ihm in Berührung kommt, wird davon aufgelöst. Der Eingeweihte weiß jedoch, daß er nur einen Hahn im Haus halten muß, um sich vor diesem Ungeheuer zu schützen, denn der Hahn ist neben einer bestimmten Wieselart der natürliche Feind des Basilisken. Bendiths sind kleine mißgestaltete Kreaturen, die einer Kreuzung von Elfen und Kobolden entstammen. Von der Schönheit, die man den Elfen nachsagt, ist ihnen nicht das geringste anzumerken, ihre Körper sind unproportioniert und degeneriert. Da sie sehr mißgünstige Geschöpfe sind, entführen sie gerne Menschenkinder und ersetzen diese durch ihre eigene häßliche Brut. Eltern, deren Kind von einem Bendith geraubt wurde, müssen jedoch nicht verzweifeln, da der richtige Zauber auch hier helfen kann. Brownies sind kleine Hausgeister, die ihren Namen der braunen Kluft eines Knechtes verdanken, die sie gewöhnlich tragen. Die schottische Mythologie beschreibt Brownies als gutmütige und hilfsbereite Wesen, welche die Frau des Hauses dadurch erfreuen, daß sie ihr die Hausarbeit verrichten. Als Dank akzeptieren sie ausschließlich eine Schüssel Milch, jede andere Art der Belohnung würde sie jedoch für immer vertreiben. Bei aller Gutmütigkeit sind Brownies sehr empfindlich. Jede Art von Neckerei beleidigt sie zutiefst und sie rächen sich bitterböse an der Person, die sie gekränkt hat. |
 Die Chimäre oder Schimäre ist ein Mischwesen aus Löwe, Ziege und Schlange, seinem Rachen entströmt Feuer und ein beißender Gluthauch. Dieses Ungeheuer verwüstete Lykien, ein Königreich in Kleinasien, indem es aus der Luft auf die Dörfer herabstieß und alles mit seinem Feueratem in Brand setzte. Mit Hilfe des wendigen Flugrosses Pegasus, das ihm von den Göttern geschickt wurde, besiegte Bellerophon das Ungeheuer in einem schrecklichen Luftkampf. Die Chimäre oder Schimäre ist ein Mischwesen aus Löwe, Ziege und Schlange, seinem Rachen entströmt Feuer und ein beißender Gluthauch. Dieses Ungeheuer verwüstete Lykien, ein Königreich in Kleinasien, indem es aus der Luft auf die Dörfer herabstieß und alles mit seinem Feueratem in Brand setzte. Mit Hilfe des wendigen Flugrosses Pegasus, das ihm von den Göttern geschickt wurde, besiegte Bellerophon das Ungeheuer in einem schrecklichen Luftkampf. |
|
Der Drache wird in den Mythologien fast aller Länder erwähnt. Die häufigste Beschreibung ist die eines gewaltigen, reptilienartigen, fliegenden Ungeheuers mit krokodilartiger Schuppenhaut, dem Schwanz einer Schlange und gewaltigen Krallenfüssen, das Feuer speit. Im germanisch-nordischen Sagenkreis wird der Drache auch als Lindwurm bezeichnet.
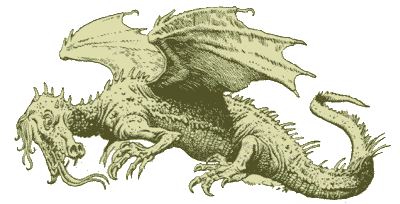 Nach und nach wurde der Drache eine begehrte Trophäe, da er nicht zuletzt aufgrund seiner magischen Begabung als nahezu unbesiegbar galt und es schon einen besonderen Helden erforderte, um einen Drachen zur Strecke zu bringen. Zudem lockte der sagenhafte Reichtum ihres Drachenhorts viele Glücksritter an. Die Dienste der Drachentöter wurden immer begehrter, da nicht wenige Gegenden von den gereizten Ungeheuern heimgesucht wurden und manche Jungfrau ihr Leben lassen mußte, um das Ungetüm zu besänftigen. Außerdem waren bestimmte Körperteile eines Drachen sehr gefragt, da ihnen magische Kräfte anhafteten. So wurde derjenige, der sich in Drachenblut badete immun gegen Stich- und Hiebverletzungen und der, welcher ein Drachenherz verspeiste in die Lage versetzt, die Sprache von bestimmten Tierarten zu verstehen. Drachenzähne ergaben ein besonderes Saatgut und der Verzehr einer Drachenzunge verlieh eine außergewönliche Redefertigkeit, die bei Streitgesprächen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil darstellte. Vielfach hört man auch, daß die Schuppen eines Drachen vor deren magischem Feuer schützen, was manchem Drachentöter seinen Beruf sehr erleichtert haben soll. Aufgrund der zunehmend besser ausgerüsteten Helden, die nicht selten magische Utensilien zur Drachenjagd benutzten, war die Gattung der Drachen bald vom Aussterben bedroht. Es ist anzunehmen, daß sich die letzten ihrer Art in Gegenden fernab von den Menschen zurückgezogen haben, wo sie nicht von Schatz- und Beutejägern belästigt werden. Um die Streitkräfte eines Landes zu vermehren, bedient man sich der Magie von Drachenzähnen. Hierzu benötigt man einen Drachen, den man "nur" fangen und erlegen muß, um ihn seiner Zähne zu berauben. Dieselben Zähne säht man nun sorgfältig in einem entsprechend vorbereiteten Acker aus und wartet auf die ersehnte Ernte. Der aufmerksame Beobachter nimmt als erstes den stählernen Glanz von Speerspitzen wahr, nach und nach gefolgt von noch unterdrücktem Kriegsgeheul, welches sich zunehmend steigert, sobald die ganze wohlgerüstete Kriegerschar dem Boden entwachsen ist. Hier stehen sie nun, aufgereiht, den ausgesähten Zähnen gleich. Doch sollte man wissen, daß diese Armee tunlichst genau zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden muß, denn sie ist derart wild und kriegerisch, daß sie kurzerhand denjenigen angreift, der gerade in der Nähe ist. Gut tut folglich derjenige, der Maßnahmen zu seinem Schutz ergreift, bevor die Kriegerschar herangewachsen und kampfbereit ist. Wenn keine Feinde greifbar sind, kann es auch vorkommen, daß sich die Krieger gegenseitig bis zum Tod bekämpfen. |
|
Harpyien sind riesige geflügelte Dämonen mit dem Gesicht einer Frau und dem Körper sowie den Schwingen eines Raubvogels. Die Götter bedienten sich dieser Kreaturen, um die Menschen heimzusuchen. So stahlen und verschmutzten Harpyien das Essen des Königs Phineus, der bei den Göttern in Ungnade gefallen war, durch heimtückische Angriffe aus der Luft, damit dieser verhungern sollte. Wenn sie auf jemanden angesetzt ist, stürtzt sich die Harpyie einem Raubvogel gleich aus der Luft auf ihr Opfer, packt es mit ihren Krallen und trägt es fort. Diese Reise endet nicht selten in der Hölle, wo das bedauernswerte Opfer ewigen Dienst tun muß, um zu büßen.
Hel ist die Herrscherin der nordischen Unterwelt Niflheim, sie ging ebenso wie auch die Jormundgand (Midgardschlange) und der Fenris aus der Verbindung des Wesens Loki und der Riesin Angerbode hervor. Hel wird als Riesin von grässlicher Gestalt beschrieben, deren eine Körperhälfte schwarz ist und es wird behauptet, daß sie sich von Menschen ernährt. Da Hel ein furchterregendes Geschöpf war und eine Bedrohung für die Asen darstellte, wurde sie von diesen in die Unterwelt geschleudert, wo sie seitdem herrscht.
Hexen werden in den Mythen der meisten Länder in den unterschiedlichsten Ausprägungen erwähnt. Sie wurden zu allen Zeiten gefürchtet. Da ihre Ursprünge jedoch in den alten Religionen zu finden waren, war ihre Stellung in der jeweiligen Kultur davon abhängig, inwieweit die traditionelle Weltanschauung noch Gültigkeit hatte. So wurden sie entweder als Personen geachtet, die mit dem Übernatürlichen in Verbindung standen und das Schicksal der Menschen beeinflussen konnten, oder sie wurden als Buhlen des Teufels verfolgt. Hexen werden meist als weibliche Wesen beschrieben, wobei die Beschreibung ihrer äußeren Gestalt von der einer schönen jungen Frau bis hin zu der einer uralten und häßlichen Greisin reicht. Hexen sind sterblich, jedenfalls in ihrer ursprünglichen menschlichen Hülle, können aber sehr alt werden. Ihnen werden sowohl gute, als auch schlechte Eigenschaften nachgesagt. Ihre guten Fähigkeiten liegen z. |
| Irrlichter sind kleine schwach flackernde Flammen, die nachts über Sümpfen und Mooren zu sehen sind, rasch aufleuchten und wieder vergehen. Der Volksglauben sieht in ihnen die Seelen von ungetauften Kindern, Selbstmördern oder Menschen, die gewaltsam umgekommen sind. Anderen Legenden zufolge soll es sich bei einem Irrlicht um die Seele eines großen Sünders handeln, dem der Teufel aus Mitleid ein paar glühende Kohlen aus dem Höllenfeuer gab, damit dieser sich auf seiner ewigen Wanderung wärmen kann. Als Inkubus wird ein männlicher Dämon bezeichnet, der sterbliche Frauen heimsucht, während sie schlafen, um bei ihnen zu liegen. Die Frau nimmt die unheimliche Vereinigung gar nicht oder nur als Traum wahr. Aus dieser unseeligen Verbindung können missgebildete, aber auch magisch begabte Kinder entstehen. Dem legendären Zauberer Merlin sagt man nach, daß er das Ergebnis einer solchen Paarung sei. Die weibliche Ausprägung des Inkubus wird als Sukkubus bezeichnet. |
Jormundgand (Midgardschlange) |
|
Kelpien sind bösartige Gestaltwandler, die mal menschliche, mal pferdeähnliche Gestalt annehmen. Sie leben in der Nähe von Gewässern, wo sie darauf warten, einen Vorbeireisenden ins Verderben zu stürzen. Wenn sie menschliche Form annehmen, schwingen sie sich hinter einem Reiter auf das Pferd und versuchen diesen mit ihren kräftigen Armen zu erdrücken, wärend sie das scheuende Pferd unbeirrbar in Richtung Wasser treiben. In der Gestalt eines Pferdes warten sie am Rande der Straße, bis jemand unvorsichtig genug ist, sich auf ihren Rücken zu setzen, dann halten sie auf das tiefe Wasser zu und versuchen denn Reiter zu ertränken.
Kobolde sind Gestalten von kleiner Statur, die sich entweder als dienstbare Hausgeister nützlich machen oder dem Menschen als Bösewichte unangenehme Streiche spielen. Es geht keine wirkliche Gefahr für den Menschen von ihnen aus, da sie auf kleinere Ärgernisse spezialisiert sind, die den Menschen jedoch durch die Häufigkeit des Auftretens in den Wahnsinn treiben können. Einen Kobold bekommt man in der Regel nicht zu Gesicht, da diese kleine Wichte viel zu geschickt sind, um sich erwischen zu lassen. Daß ein Mensch dem Schabernack eines Kobolds zum Opfer gefallen ist, merkt er allenfalls an dem hinterlistigen Gekicher, mit dem der Kobold seiner Freude über den gelungen Streich Ausdruck verleiht.
|
|
Die Walhall ist die Ruhmeshalle, in welcher Odin die in der Schlacht gefallenen Krieger, die Einherier empfängt. Ihre Seelen werden von den jungfräulichen Botinnen Odins, den Walküren in die Walhall geleitet. Die Ruhmeshalle hat 540 Türen, durch die 800 Helden zur gleichen Zeit eintreten können. Nur die tapfersten und mutigsten Krieger werden von Odin eingelassen und ihre Wunden heilen, sobald sie die Halle betreten. Die Helden, die hier angelangt sind kämpfen bei Tag und können sich dann, wenn ihre Wunden verheilt sind, an den ausschweifenden und reichhaltigen Gelagen erfreuen, die Odin nachts wieder für sie ausrichtet. Diese finden jedoch ein Ende, wenn die letzte große Schlacht kommt, die mit Ragnarok, dem Untergang der Götter enden wird. Aus diesem Grund hat Odin die Halle erschaffen und seine besten Krieger um sich versammelt, denn er will auf den letzten Kampf gegen die feindlichen Mächte, die von dem Gott Loki angeführt werden, vorbereitet sein.
Der Begriff Werwolf bezeichnet das Mysterium, daß sich ein Mensch unter besonderen Umständen nachts in ein Tier verwandeln kann und bei Tagesanbruch wieder seine menschliche Gestalt annimmt. Die meisten Sagen berichten von Männern, die aufgrund ihres familiären Erbgutes oder infolge einer Verletzung, die sie durch eine solche Kreatur erhalten haben, in bestimmten Nächten zu einem Tier (meist zu einem Wolf) mutieren. Das Wesen, in welches sie übergehen wird als unheilvoll und raubtierhaft beschrieben. Sogar Familienmitglieder werden von ihm angegriffen, da das Wesen offenbar keine Erinnerung an seine jeweils andere Existenz besitzt. So kann sich der Betroffene, sobald er seine menschliche Gestalt wieder besitzt, nicht mehr an seine nächtliche Jagd erinnern. Die Erinnerung kann in Form von Traumbildern zurückkehren, das scheint aber eher selten der Fall zu sein. Je länger der Mensch von diesem Phänomen befallen ist, desto geringer werden die Abstände zwischen den Gestaltwandlungen, bis er schließlich ganz von der Gestalt des Tieres übernommen wird. Demzufolge hat derjenige die größte Chance auf Heilung, der frühzeitig Hilfe durch eine erfahrene Person erhält. Andernfalls kann der Kreis nur durchbrochen werden, indem man ihn mit Hilfe eines Gegenstands aus Silber erlöst und dadurch seiner Seele Frieden schenkt. |
|
Agir--In der altnord. Mythol. der reiche und den Göttern gegenüber gastfreundliche Riese des ruhigen Meeres. König der Meerriesen, Sohn des Miskorblindi, Gatte der Ran und Vater der Kolga. Seine Diener sind Eldir und Fimafeng.
Agnar--der Bruder des Geirröd. Lebt mir einer Riesin in einer
Höhle.Schützling der Frigg.
Agnar --Bruder des Helmgunther.
Alben--Elfen
Albrunen--weissagende Frauen.
Alfadur-- der Allvater.
Alfar-- Elfen
Alfheim--Reich der Elfen und des Frey.
Alfhild-- die schönste der Elfen. Von Starkad geraubt.
Allwiß-- eine Walküre.
Alp--Truggeister. Unholde, die sich auf die Beust des Schlafenden setzen und diesen zu erwürgen drohen.
Alphart--Bruder des Wolfhart. Wird von Wittich und Heime erschlagen.
Angerbode--"die Schadenbotin", eine Riesin. Mutter der Hel, der Midgardschlange und des Fenris.
Asen--In der altnord. (isländ.) Mythol. das wichtigste Göttergeschlecht (Odin, Balder, Loki, Bragi,Forseti, Frigg, Gerda, Heimdall, Hel, Hödur, Thor, Tyr, Wali, Widar, Hönir, Uller und Iduna).Wohnen in Asgard. Konkurenten der Wanen.
Asgard--der Wohnsitz der Asen in den Luftgefilden. Zwischen ihm und Midgard spannt sich die Brücke Befröst. Asgard
(Asgardr nord. Asenwelt, -raum, Heim der Asen)
In der nordgermanischen Mythologie ist Asgard die Himmelswelt
und Wohngebiet der Asen. Asgard ist eine Burg mit den Sälen Folkwang und Walhall und den Höfen Idafeld und Wingolf.Im Zentrum liegt eine große Halle für Versammlungen, Feste und Gericht mit zwölf Hochsitzen für die Götter. Von seinem Thron Hlidskialf überblickt Odin die ganze Welt. Asgard liegt oberhalb von Midgard und von Utgard. Die Brücke Bifröst verbindet Asgard mit Midgard, der Fluß Ifing trennt Asgard von dem Riesenland Jötunheim. Das von den Asen besiegte Göttergeschlecht der Vanen wohnt in Wanaheim. Zu Ragnarökkr werden auch Asgards mächtige Mauern einstürzen.
Der Bau Asgards
Die Götter bedienten sich zum Auftürmen von Asgards mächtigenMauern des Steinmetzen Hrimthurs. Dem war als Lohn für seine Arbeit die Hand der Fruchtbarkeitsgöttin Freyja versprochen, außerdem sollte er Sonne und Mond erhalten.Damit der Preis nicht entrichtet werde müsste, riet Loki,
dem Baumeister eine unmöglich scheinende Frist zu setzen.
Nur wenn er binnen sechs Monaten fertig würde, sollte er seinen Lohn erhalten. Der willigte ein, durfte sich aber von seinem wunderbaren Pferd Svadilfari helfen lassen.
Torbogen fehlte noch. Ein weiteres Mal springt der listige Loki ein und verwandelt sich in eine Stute. In dieser Gestalt verführt er den Hengst Svadilfari und Hrimthurs säumt die vereinbarte Frist. Wütend entpuppt er sich als Riese, den sogleich Thor mit seinem Mjöllnir zerschmettert.
Die Geschichte vom Handel beim Bau Asgards ähnelt vielen Sagen, die davon berichten, wie der Teufel dem Baumeister bei der Errichtung von Brücken oder Dombauten behilflich ist. Wird er am Einsetzen des Schlußsteines gehindert, fährt er wütend zur Hölle, gelingt ihm der Bau in der vereinbarten Frist, fällt ihm die Seele des Baumeisters zu.
Ask--"Esche", der Stammvater der Menschen. Mit Embla bildete er das Erste Menschenpaar das von den Göttern geschaffen wurde. Erhielt von Odin die Seele, von Wili die Klugheit und von We das Leben.
Balder-- Gott der Güte und des Lichtes, Gott des Sommers und des Gewitters vom Geschlecht der Asen. Sohn des Odin und der Frigg, Gatte der Nanna und Vater des Forseti. Besonders gut, weise, freundlich, jung und schön. Kühner Feind allen Unrechts.Das Heil der anderen Götter hängt von seinem Leben ab. Er ist unsterblich, weil alles auf der Welt einen Eid abgelegt hatte, Balder niemals zu verletzen. Nur die Mistel wurde nicht vereidigt.Somit stirbt Balder an einem Mistelzeig, den Loki dem blinden Hödur in die Hand gibt, der ihn damit unabsichtlich tötet. Da zwar alle seinen Tod beweinten nur Loki nicht, konnte er nicht aus der Unterwelt zurückkehren. Sein Bruder Wali rächt seinen Tod. Dem Tode Balders folgt der Untergang der Götter im Ragnarök. Sein Wohnsitz ist Breidablik, sein Schiff Ringhorn.
Beberast--die Regenbogenbrücke zwischen Asgard und Mitgard
Belblindi--"Finster, wie die Unterwelt", Bruder des Loki.
Bergelmir--der einzige Riese, der den Kampf zwischen Asen und Riesen überlebt.Urvater einer neuen Generation von Riesen, der Jöten.
Bifröst--"der schwankende Weg", die Himmelsbrücke,
über die die Asen zum Gerichtsplatz ziehen.
Brimir--ein Riese.
Brunhild--Nibelungen-) Sage "die Kämpferin im Panzerkleide", einstige Walküre. Königin auf
Dankwart--In der germ. (Nibelungen-) Sage der Bruder des Hagen von Tronje. Von Helferich in der Schlacht zwischen Hunnen und Burgunden getötet.
Disen--Schutzgeister der Männer in Frauengestalt (Walküren). Sie erscheinen ihren Schutzbefohlenen warnend in Träumen. Töteten Thidrandi.
Donar--Thor
Draupnir--In der altnord. Mythol. "der Tröpfler", der Goldring des Odin, der von dem Zwerg Sindri gefertigt wurde. Er ist das Symbol der Sonne. In jeder neunten Nacht tropfen acht gleiche Ringe von ihm ab.
Edda--(übersetzt: "die Großmutter") Bezeichnung des Gesamtheit der nord. Mythologie, enthält Götterdichtung, Spruchweisheiten und Heldengesänge der Germanen.
Einherjer--In der altnord. Mythol. "Auserwählte Kämpfer", die im Kampfe gefallenen Helden, die Odin nach ihrem Schlachttod nach Walhall gerufen hat, wo sie sich täglich bekämpfen, aufs neue töten und wieder versöhnen.
Elben--Elfen
Elfen--Naturgeister (Thjalfi, Rådande, Alfhild, Gudmund, Althjof, Hlethjof, Fundin, Oberon, Kobolde). Verkörpern Licht oder Dunkelheit, erscheinen jung und schön, aber auch als alte Hexen und bringen Heil und Glück oder Krankheit und Tod. Leben in Alfheim.
Fenris—(auch Fenrir) der Götterwolf-- Fenriswolf. Sein Maul reicht vom Himmel bis zur Erde.
Forseti--Friedens- und Gerechtigkeitsgott und göttlicher Richter vom Geschlecht der Asen.
Freki-- "der Heißhungrige", einer der beiden Wölfe des Odin (siehe Geri),die als Totentiere des Schlachtfeldes ständige Begleiter Odins sind.
Frey--"Herr", Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte vom Geschlecht der Wanen.
Freyja--Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin vom Geschlecht der Wanen. Führerin der Walküren. Lebt seit dem Wanenkrieg als Geisel bei den Asen. Tochter des Njörd und der Skadi, Geliebte des Odur und Mutter der Hnoss und der Gersimi. Sie ist jung und schön und bedient die Götter bei ihren Gelagen. Erhält nach Schlachten eine Hälfte der Toten von Odin.
Frigg--"die Geliebte", Göttin der Fruchtbarkeit und des Herdes und Göttermutter vom Geschlecht der Asen. Gattin des Odin und Mutter des Tyr, des Bragi, des Balder und des Hödur. Steht ihrem Gatte Odin stehts warnend und beratend zur Seite. Ihr werden unkriegerische Feinde zum Opfer ebracht, in dem man diese in Sümpfe wirft. Ihre Dienerinnen sind Wara,Sygn und Gna. ihr Wohnsitz ist Sökkvabekk und Fensal und ihr Schützling ist Agnar.
Garm--" der Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Sohn des Fenrir. Beim Ragnarök ist er ein Verbündeter der Riesen und verschlingt die Sonne.
Geirröd--ein grausamer König. Bruder des Agnar und Vater des jungen Angar. Wurde von Odin erzogen.
Geirröd--ein Riese, der von Thor mit einem glühenden Stück Eisen erschlagen wurde.
Geri--"der Gierige", einer der beiden Wölfe des Odin (siehe Freki), die als Totentiere des Schlachtfeldes ständige Begleiter Odins sind.
Glasir--der Hain vor Walhall, dessen Bäume goldene Blätter tragen.
Gleipnir--eine Zauberfessel, mit der Fenrir gefesselt worden ist. Wurde von den Zwergen aus dem Bart der Weiber, dem Schall des Katzentrittes, der Stimme der Fische, dem Speichel der Vögel, der Sehnen der Bären und der Wurzeln der Berge gescmiedet.
Gungnir--der goldene Wurfspeer des Odin, der von Zwergen geschmiedet wurde.
Heimdall--"Weltglanz", Schutzgott und Gott des morgendlichen Sonnen- und Tageslichtes vom Geschlecht der Asen. Sohn des Odin und der Wellen des Meeres
Hel--Nifelheim
Hel--Todes- und Unterweltsgöttin vom Geschlecht der Asen. Tochter des Loki und der Angerbode. Dunkle und männerfressende Gestalt, zu welcher die an Krankheit und Altersschwäche gestorbenen Menschen kommen. Ihr Saal ist Eljudni und ihr Ross ist Helhesten.
Hödur--ein blinder, aber sehr starker Ase. Sohn des Odin und der Frigg und Gegner und Mörder Balders. Tötet Balder mit einem Mistelzeig, den Loki ihm in die Hand gab. Wird von Wali getötet.
Hugin--"der Denker", einer der beiden Raben des Odin (siehe Munin), die als Kundschafter um die Welt fliegen.
Hulda-- . Frigg als Totengöttin. Aber auch Göttin des Segens, der Erde und des Hauses. Ihr Volk sind die Elfen und die Hexen. Zu ihr kommen die Seelen der sterbenden Kinder. Sie bringt den Guten Glück und den Bösen Unglück.
Hymir--ein Frostriese.
Kolga--"die Kalte". Tochter des Ägir.
Lodur—Loki "der Feuerbringer", Gott der Ehe vom Geschlecht der Asen. Sohn des Farbaute und der Laufey, Bruder des Byleist und des Belblindi, Gatte der Sigyn und Vater der Hel, des Nörfi, des Fenrir, der Menschenfresser, der Mittgardschlange und in eine Stute verwandelt des Sleipnir. Er ist der schlaue und listige Spötter unter den Gottheiten. Er begleitet Thor auf dessen Reisen durch das Land der Riesen. Er kämpfte teils mit den Göttern, aber teils auch gegen sie. Gab Hödur den Mistelzweig in die Hand, mit dem dieser Balder tötete.Zur Strafe für seine Mitschuld am Tode Balders und weil er sich weigerte auch nur eine Träne um ihn zu weinen, damit dieser aus dem Totenreich zurückkehren kann, wurde er mit Wolfsdärmen an einen Felsen gefesselt, wo er unentwegt mit Schlangengift betreufelt wird.
Sein Aufbäumen gegen die Strafe läßt die Erde erbeben. Er kommt erst beim Ragnarök wieder frei und kämpft dann, als Anführer, mit Fenrir und der Midgardschlange gegen die Götter. Wurde,nachdem er aus Asgard verbannt worden war zu Uttgardloki.
Magni--"Kraft". Sohn des Thor und der Sif.
Midgard--der mittlere Teil der Welt zwischen der Feuerwelt im Süden und der Eiswelt im Norden, in dem die Menschen hausen. Wurde aus den Brauen des Ymir erbaut.Um Midgard herum fließt der Ozean, in dem die Midgardschlange haust. Die Brücke Beberast verbindet Midgard mit Asgard.
Midgardschlange--die Schlange, die in dem Ozean, der Midgard umfließt, haust und die Welt umspannt. Tochter des Loki und der Angerbode und Verbündete der Riesen. Beim Ragnarök tötet ihr Gift Thor, nachdem dieser sie erschlagen hat.
Mjöllnir--"Zermalmer", der Kampfhammer des Thor, der von dem Zwerg Sindri geschmiedet wurde. Mit ihm erzeugt Thor Blitz und Donner. Er verfehlt nie sein Ziel und kehrt nach jedem Wurf von selbst in Thors Hand zurück. Thor bekämpft mit ihm stehts siegreich die Riesen.
Munin--"der Erinnerer", einer der beiden Raben des Odin (siehe Hugin),die als Kundschafter um die Welt fliegen.
Nidhögg--In der altnord. (isländ.) Mythol. ein giftiger Drache, der an der Wurzel Yggdrasils nagt und sich vom Fleisch toter Männer ernährt.
Nornen--Schicksalsgöttinen (Urd, Werdandi und Skuld). Entstammen dem Riesengeschlecht. Sie spinnen und weben die Fäden des Geschicks. Wohnen in der Halle bei der Weltesche Yggdrasil.
Odin--"der Wütende", oberster, einäugiger Gott. Gott des Krieges, der Toten, der Dichtkunst, der Zauberkunst, der Runen, des Sturmes und der Ekstase vom Geschlecht der Asen. Göttervater der Asen, Führer der wilden Jagd, Sohn des Bor und der Bestla, Gatte der Frigg, Vater des Tyr, des Thor, des Wali, des Bragi, des Widar, des Balder, des Hermod, des Hödur, des Skjöld, des Säming, des Sigi und des Heimdall, Geliebter der Jörd, der Gunnlöd und der Grid und Ziehvater des Starkad. Schuf zusammen mit seinen Brüdern Wili und We die Welt aus dem Körper des Ymir und gab den Menschen die Seele. Er ist der Besitzer des Dichtermets Odrörir, reitet auf Sleipnir durch die Wolken und teilt nach Schlachten die Toten mit Freyja und Frigg. Seine Wohnsitze sind Valaskjalf, Sökkvabekk und Gladsheim mit der Halle Wallhall und sein Thron ist Lidskjalf.
Odur--Gott der Dichtkunst und der Weisheit. Entstand aus dem gemeinsamen Speichel der Asen und der Wanen. Geliebter der Freyja. Von Fjallar und Gjallar ermordet. Er übertrifft an Weisheit alle Götter und Menschen. Aus seinem Blut, vermengt mit Honig, wurde der Med Odrörir gefertigt.
Ragnarök--"letztes Geschick", der Weltuntergang. Ihm voraus geht der Kampf zwischen Göttern und Riesen und ihren Verbündeten, wobei sie sich gegenseitig vernichten. Dann stirbt die Erde in einem gewaltigen Brand, den der Feuerriese Surt entfacht. Aus den Wassern des Ozeans entsteigt jedoch eine neue, friedliche Welt, in der ehemalige Feinde versöhnt leben.
Skuld--"Schicksal", jüngste der drei Nornen. Norne der Zukunft. Tochter des Helgi und einer Elfe.
Sleipnir--"der schnelle Läufer", das achtbeinige, magische, weiße Schlachtroß des Odin. Sohn des Loki und des Swadilfari. Gilt als das schnellste aller Pferde.
Thor--"der Donnerer", Gewittergott vom Geschlecht der Asen. Schützer Midgards, ihrer Bewohner des häuslichen Herdes und der Familie. Sohn des Odin und der Fjörgyn, Bruder des Meili, Gatte der Sif, Vater des Magni, des Modi und der Thrud und Stiefvater des Uller. Seine Pflegesöhne sind Wingni und Hlora. Mann im besten Alter mit rotem Bart, von kräftiger Gestalt, gutmütig, bieder und ehrlich, aber auch leicht erregbar und zornig. Erzeugt mit seinem Hammer Mjöllnir die Blitze. Mit Mjöllnir, bekriegt er auch stehts siegreich die Riesen. Machte sich dabei wegen seiner Einfalt und Naivität immer etwas lächerlich. Seine Diener sind Thjalfi und Röskwa, sein Reich ist Thrudwanger mit der Burg Bilskirnir und seinen Wagen ziehen die Böcke Zähneknirscher und Zähneknisterer.
Thrud--"Kraft". Tochter des Thor und der Sif.
Tyr--einarmiger Kriegsgott. Sohn des Odin und der Frigg.
Urd--"die Spinnerin", die älteste der drei Nornen. Norne der Vergangenheit.
Urdbrunnen--der Brunnen am Fuße der Yggdrasil, an dem die drei Nornen ihren Sitz haben.
Valhall—Walhall --"Halle der Gefallenen", die Schlachtfeld- und Trinkhalle des Odin, in die die gefallenen Krieger von den Walküren geleitet werden. Größte Halle in Gladsheim.
Wali--"der Glänzende", Frühlingsgott vom Geschlecht der Asen. Sohn des Odin und der Rinda und Rächer des Balder, in dem er Hödur tötet. Ein guter Krieger und Schütze. Nach dem Ragnarök erschaft er zusammen mit Widar die neue gute Welt.
Walküren--"die Kampftöterinnen", die göttlichen Botinnen des Odin (Freyja, Allwiß, Ölrun, Sigrun, Brunhild, Brünhild, Grimhild, Gudrun, Signy, Sigrlin, Swanwit, Swanhild, Swawa, Kara). Sie gehören zu den Disen. Sie bestimmen den Tod der Krieger auf dem Schlachtfeld und geleiten die gefallenen Krieger nach Walhall. Dort bewirten sie die Einherjer.
Wanaheim--das Reich der Wanen.
Wanen--"die Leuchtenden", ein Göttergeschlecht (Frey, Freyja,
Njörd,Gefion und Nerthus). Nachkommen der Nerthus. Versöhnen sich nach dem Wanenkrieg mit den Asen. Leben in Wanaheim.
Wili --einer der ersten drei Götter. Sohn des Bor und der Bestla. Schuf zusammen mit seinen Brüdern Odin und Loki die Welt aus dem Körper des Ymir. Gab den Menschen die Klugheit.
Wodan--Odin
Yggdrasil--die immer grüne Weltesche, an deren Wurzel drei Brunnen entspringen: Mimis Weisheitsquelle, die Quelle Hvergelmir und der Urdbrunnen. Der allweise Adler und das Eichhörnchen Ratatorsk sitzen in den weltumspannenden Ästen und vier Hirsche(Eikthyrnir, Dwalin) äsen an seinem Wipfel Lärad. Die Wurzeln, an denen ein Drache nagt,reichen bis Niflheim, zu den Menschen und den Frostriesen. Ein Beben des Baumes kündigt den Ragnarök an.
---> HIER GEHTS NACH YGGDRASIL <---
Ymir--"der Rauchende", der sechsköpfige Urriese, der aus den
Schmelzwassern der Eliwager entstand. Wird von Audumla ernährt. Vater der Riesen und der ersten Götter. Aus seinem Körper erschufen Odin, Wili und We die Welt: Aus seinem Fleisch die Erde, aus dem Blut das Meer und aus seinem Schädel der Himmel.
Mittelalterliche Fachbegriffe
Aderlaß:
Meist gegen alle Krankheiten angewendete Standardheilmethode, bei der dem Patienten eine Vene geöffnet wird, um die Krankheit mit dem Blut herausfließen zu lassen. Welche Vene (und an welcher Stelle) geöffnet wurde hing von der Stellung der Gestirne, des Mondes und der Jahreszeit ab.
Alchimie:
Vorläufer unserer heutigen Wissenschaft Chemie. Bei der Suche nach dem "Lebenselixier" und dem Versuch der "Goldherstellung" aus anderen Metallen, entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte erste wissenschaftliche Arbeitstechniken und Arbeitsgeräte.
Allmende:
Landbereich, der von allen Einheimischen frei genutzt werden konnte. Da es sich hierbei hauptsächlich um recht unfruchtbares Land handelte, wurde es als Weideland genutzt.
Almosen:
Spenden für die Armen. Da es als edel galt den Armen zu helfen, wurden Almosen oft in Form von übriggebliebenen Lebensmitteln nach einem Fest verteilt.
Almosenpfleger:
Von einem Adligen beauftragte Person, welche die Almosen an die Ärmsten der eigenen Bevölkerung verteilte.
Amme:
Dienstmagd, die einen Säugling anstatt der Mutter stillt und sich um ihn kümmert.
Angstloch:
Meist runde Öffnung oberhalb des Verließes, durch die ein Gefangener mit Hilfe eines Seils, einer Leiter o. ä. hinabgelassen wurde. Ihr Durchmesser betrug etwa einen Meter, oft wurde sie mit einer Steinplatte oder einer Holztür verschlossen.
Antwerk:
Auch Zeug genannt. Mittelalterlicher Oberbegriff für die, bei einem Angriff auf eine Burg benutzten Belagerungsmaschinen, wie den Belagerungsturm
Ätzender Kalk:
Variante des bei einer Belagerung von den Verteidigern üblicherweise benutzten heißen Öls oder Pech. Siedendes Wasser wird mit ungelöschtem Kalk versehen und auf den Angreifer geschüttet. Dies verursacht schwere Verätzungen.
Ausfalltor:
Kleines Tor einer Festung von dem aus die Verteidiger Überraschungsangriffe führen konnten. Meistens war es oben im Mauerwerk angelegt und wurde über eine Leiter verlassen.
Ausglühen:
Angewendete Technik nach dem Schmieden von Eisen, um eine stärkere Erhärtung der Oberfläche des Metalls zu erhalten. Das fertig geschmiedete Werkstück wird im letzten Arbeitsgang ganz langsam erhitzt und so bruchfester und härter.
Aussätziger:
Erkrankte Person, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Ursprünglich handelte es sich ausschließlich um an Lepra erkrankte Menschen. Der Begriff wurde aber mit der Zeit auf alle Kranken angewendet, die von der Bevölkerung gemieden wurden (Aussatz). Die Kranken mußten Rasseln tragen, um andere frühzeitig vor ihrem Erscheinen zu warnen.
Bader:
Volkstümliche Bezeichnung für Barbier. Es handelte sich um den Betreiber einer Badestube, der außer dem Schneiden der Haare auch oft die Aufgaben des heutigen Chirurgen oder Zahnarztes übernahm.
Badezuber:
Für das Baden benutzter Wasserbehälter. Von der Konstruktion her aufgebaut wie ein stehendes, halbes Faß, daß an den Rändern oft mit Stoff ausgepolstert wurde.
Bärenhatz:
Marktspektakel bei dem der Besucher gegen einen Einsatz seinen Hund auf einen angeketteten Bären hetzen konnte. Heulte der Bär auf, erhielt der Hundebesitzer einen Gewinn.
Baumeister:
Leiter des Aufbaus einer Festung oder Kathedrale. Meistens ein erfahrener Maurer– oder Steinmetzmeister. Seine Aufgaben beinhalten sowohl den Entwurf als auch den Aufbau des Objekts.
Die Übernahme einer solchen Aufgabe versprach eine sehr gute Bezahlung sowie eine hochangesehene Stellung in der Gesellschaft.
Beize:
Tierfäkalien, in welche Lederhäute eingelegt wurden, damit diese besonders weich wurden.
Beizjagd:
Jagd von Vögeln und anderen Kleintieren mit Hilfe von abgerichteten Raubvögeln wie Habichte und Falken. Diese Art der Jagd war dem Adel vorbehalten.
Bergfried:
Mhd. Berchfrit o. Belfried. Hauptturm der Burg, wurde als letzte Verteidigungsstellung genutzt, falls es dem Belagerer gelang, in die Burg einzudringen. Innerhalb des Bergfrieds wurden Vorrats- und Waffenkammern angelegt. Unterirdisch war hier auch oft der Kerker der Burg zu finden.
Besthaupt:
Besondere Abgabe an den Grundherrn im Todesfall eines Leibeigenen. Im Normalfall das beste Stück Vieh oder beste Kleid (deshalb auch Bestkleid genannt).
Bier:
Da Wasser durch Bakterien, die damals unbekannt waren, oft Krankheiten verursachte, war Bier neben Wein eines der Hauptgetränke der Bevölkerung. Aufgrund seines Zuckergehaltes war es für diejenigen, die sich keine gute Ernährung leisten konnten ein wichtiges Grundnahrungsmittel.
Binsen:
Getrocknetes Schilf, mit dem der Boden in Räumen ausgelegt wurde.
Brandmarke:
Mit einem glühenden Eisen für kleine Vergehen beigebrachte, sichtbare Markierung, um den Täter in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Die noch heute benutzten Begriffe "gebrandmarkt" und "Schandmal" haben hier ihren Ursprung.
Burg:
Mittelalterliche Wehranlage, die gleichzeitig als Wohnsitz diente. Sie bestand aus Befestigungsmauern, Wachtürmen, dem Bergfried, dem Wohnbau (Palas) und Wirtschaftsgebäuden. Die Gebäude wurden um einen Innenhof, den Burghof, angelegt. Dieser wurde mit einem Vorhof, dem sog. Zwinger verbunden. In den Zwinger gelangte man durch das Torhaus, das meistens durch eine Zugbrücke gesichert wurde.
Burgvogt:
Oberster Verwalter einer Burg und Stellvertreter des Burgherrn. Er organisierte den täglichen Arbeitsablauf auf der Burg.
Büttel:
Vom Grundherrn eingesetzter Amtsträger ähnlich einem heutigen Polizisten. Er diente auch gleichzeitig als Verwalter auf den Ländereien des Herrn und sammelte die Abgaben, sprich Steuern, ein.
Dechsel:
Werkzeug der Zimmerleute zur Holzbearbeitung. Es handelt sich um eine Axt, deren Blatt aber quer zum Schaft steht. Sie ist vor allem geeignet, die Rinde von einem Holzstamm abzulösen.
Dichtung:
Vor allem im Mittelalter durch die Minne (Minnesang), d.h. durch die (s. a. Minsänger) bestimmt. Eine hochangesehene Dichtkunst, welche die idealisierte Liebe eines Ritters zu einer Edelfrau beschrieb, der er bedingungslos diente.
Dokument:
Wichtige Verträge und Gerichtsentscheidungen wurden auf Pergament (einer Tierhaut) schriftlich festgehalten.
Dreifelderwirtschaft:
Anbaumethode, die sich im Dreijahreszyklus wiederholte, um einen Boden fruchtbar zu halten. Im ersten und zweiten Jahr wurden unterschiedliche Pflanzenarten angebaut. Im dritten Jahr wurde das Feld dann als Weideland genutzt und somit natürlich gedüngt.
Dynastenburg:
Burg eines Herrscherhauses. Sie wird somit zum Verwaltungssitz des gesamten Fürstentums.
Ebenhoch:
Auch Wandelturm genannt. Belagerungsturm aus Holz, der auf Rädern bewegt wurde und mit einer Fallbrücke versehen war. Wenn die Angreifer ihn nahe genug an die Burgmauer gebracht hatten, ließ man die Brücke herab. Die Belagerer, die sich nun auf gleicher Höhe mit den Verteidigern befanden, versuchten über die Brücke in die Burg einzudringen.
Egge:
Werkzeug zur Feldbearbeitung. Ein aus Holz gefertigtes Gitter mit Rahmen, an dem Spitzen angebracht sind, die nach dem Pflügen des Feldes größere Erdbrocken zerkleinern. Die Egge wurde von Pferden (sog. Ackergaulen) oder Ochsen gezogen.
Einsalzen:
(Pökeln) Methode um Fleisch und Fisch haltbar zu machen. Das Fleisch wird entweder in eine stark salzhaltige Flüssigkeit eingelegt oder mit Salz eingerieben und dann mit einer Salzschicht abgedeckt. Fleisch und Fisch kann auf diese Weise für Monate konserviert werden, da das Salz den fleischzersetzenden Bakterien nötiges Wasser entzieht.
Fahrender Händler:
Kaufmann, der mit seinen Waren durch das gesamte Land reiste. Oftmals hatten die Fahrenden Händler einen schlechten Ruf, denn eine spätere Beanstandung ihrer Waren, welche sie als beste Qualität anpriesen, war fast unmöglich, da sie sich bereits am nächsten Tag an einem anderen Ort befanden.
Falkner:
Ausbilder und Trainer der Raubvögel eines Adligen, die zur Beizjagd genutzt wurden. Da sich diese Tiere nur schwer an den Menschen gewöhnen, trennte sich der Falkner so gut wie nie davon.
Fallgatter:
Eisenbeschlagenes Gitter aus Holz, das von oben in den Haupttorweg herunter gelassen werden konnte. Oft wurden sowohl am Eingang als auch am Ausgang des Torwegs Fallgatter eingerichtet, um Angreifer in eine Falle locken zu können.
Fastentage:
Im Mittelalter von der kath. Kirche angeordnete Tage, an denen kein Fleisch gegessen werden durfte. Neben der Fastenzeit kamen zusätzlich die Wochentage Dienstag, Freitag und Samstag hinzu.
Fehde:
Im Mittelalter anerkannte Form der Selbsthilfe, die eine Person, deren Rechte verletzt worden waren gegenüber demjenigen anwendete, der den Rechtsbruch begangen hatte. Die Fehde wurde oft gewaltsam geführt, gegen Ende des Mittelalters im
Feudalismus:
Staats– und Gesellschaftsform des Mittelalters, die Herrschaft einer sich auf Grundbesitz stützenden adligen Oberschicht, die zusätzlich besondere Verwaltungsvorrechte gegenüber der landlosen Bevölkerung besaß.
Feuerprobe:
Art eines Gottesurteils, bei dem der Beschuldigte ein glühendes Eisenstück mit den Händen tragen mußte. Schaffte er die vorgesehene Strecke, ohne Brandwunden zu erhalten, galt er als unschuldig. Gewicht des Eisens und Wegstrecke waren von der schwere des Verbrechens abhängig.
Flamme:
Wimpel an der Lanze eines Ritters. Seit dem 12. Jh. üblich und mit den persönlichen Farben und Zeichen des Trägers versehen.
Freie:
Personen im Mittelalter, die im Gegensatz zum Leibeigenen von einem Grundherrn (d.h. Adligen) persönlich unabhängig, also frei waren. Sie konnten selbst über ihren Wohnort, ihren Ehegatten, ihre beruflicher Tätigkeit und deren Ausübungsregeln bestimmen. Rechtlich waren sie besser vor willkürlichen Übergriffen der Adligen geschützt als die (s.)
Freibauer:
Bauer, der eigenes Land besaß oder gepachtet hatte. Im Gegensatz zum Leibeigenen war er nicht vom Grundherrn persönlich abhängig. Dies beinhaltete die freie Wahl des Wohnorts, des Ehegatten und der Auftragsarbeiten für andere. Er konnte nicht willkürlich verhaftet und bestraft werden.
Frondienst:
Jeder Leibeigene mußte seine Arbeitskraft für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr seinem Grundherrn unentgeltlich zur Verfügung stellen. Unabhängig davon mußte er zusehen, daß die restliche Zeit ausreichte, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Fußvolk:
Bezeichnung für alle Soldaten, die nicht beritten waren, also Infanterie und Bogenschützen.
Futterabgabe:
Abgabe (Steuer) der Leibeigenen an den Grundherrn in Form von Getreide für dessen Pferde.
Galgen:
Bezeichnung einer Holzkonstruktion an der Verurteilte so lange aufgehangen wurden, bis der Tod eintrat. Es handelt sich um die gebräuchlichste Art der Todesstrafe im Mittelalter. Der Galgen wurde auf einem öffentlichen Platz aufgebaut.
Geächtete:
Geflohene Personen, die wegen eines schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden waren. Sie waren Ausgestoßene, die als vogelfrei (rechtlos) galten, d.h. jeder konnte sie töten, ohne seinerseits rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.
Gebet:
Aufgrund der Frömmigkeit im Mittelalter war es üblich mehrmals täglich zu beten. Im frühen Mittelalter kniete man sich zum Beten nicht mit gefalteten Händen hin. Man betete mit ausgebreiteten Armen, oder legte sich in dieser Betposition zusätzlich auf den Bauch um besondere Demut auszudrücken.
Gebißstange:
Teil des Zaumzeugs der Pferde. Ein Eisenstab, der quer im Maul des Reittiers liegt und zur sog. Trense gehört. Wurde für jedes Pferd als Einzelstück vom Schmied angefertigt.
Gefängnis:
Auch Kerker genannt. Die uns heute bekannte Gefängnisstrafe wurde im Mittelalter erst sehr spät (ca. ab 1200 A.D.) eingeführt. Vorher war ein Gefängnis lediglich ein Verwahrungsort für Gefangene bis zu deren Verurteilung. Für die Unterbringung mußte man üblicherweise selbst aufkommen (z.B. Verpflegung, Feuerholz, Stroh zum Schlafen).
Geisel:
Bei einer Schlacht oder Belagerung nahm man adelige Personen gefangen, diese wurden zur Geisel und konnten durch ein oft sehr hohes Lösegeld von ihren Familien freigekauft werden. Ein im Kampf unterlegener Ritter konnte mit den Worten: "Ich bin Euer Gefangener" anzeigen, daß er sich ergab und das Recht in Anspruch nahm, gegen ein Lösegeld frei gelassen zu werden. Damit wurde nach mittelalterlicher Sitte ein Vertrag geschlossen. Die Geisel versprach gleichzeitig keinen Fluchtversuch zu unternehmen, was ihr ermöglichte, eher als Gast denn als Gefangener behandelt zu werden. Auf der Burg wo die Geisel inhaftiert wurde konnte sie sich dann frei bewegen.
Geldstrafe:
Für viele kleinere Straftaten (Vergehen) wurden im Mittelalter Geldstrafen an den Grundherrn gezahlt. Hierunter fielen Vergehen wie: unerlaubte Nutzung von Weideland oder unerlaubtes Brennholzsammeln.
Gemach:
Bezeichnet die privaten Räume einer wohlhabenden Person. In diese konnte sie sich zurückziehen um ungestört zu sein. In den Gemächern befand sich auch der Schlafplatz.
Gemeine Figur:
Symbol im Wappen eines Edelmannes, das sich vom geometrisch aufgeteilten Hintergrund (Heroldsbild) abhebt. Sehr beliebt waren Tiermotive in allen Variationen. Der Begriff "gemein" bezeichnet die Schlichheit des Symbols, da dieses einfach und von anderen leicht zu unterscheiden sein sollte. (s. Heraldik)
Gerber:
Auch Lederer genannt. Handwerker, der Leder aus Tierhäuten herstellt.
Gerberlohe:
Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Leder benutzt wird. Es handelt sich um mit gemahlener Eichenrinde versetztes Wasser, in welches der Gerber die Tierhaut einlegt, um sie haltbarer zu machen.
Gewürze:
Gewürze waren sehr kostbar, da die meisten nach Europa importiert werden mußten. Bekannt waren neben Salz u. a. Anis, Buchweizen, Gewürznelken, Ingwer, Kreuzkümmel, Koriander, Muskat, Pfeffer, Safran, Süßholzwurzel, Zimt, Zucker. Oft waren Speisen sehr stark gewürzt, dies sollte Wohlstand demonstrieren.
Gilde:
Im Mittelalter entstandene Vereinigungen von Handwerkern zur Wahrung ihrer Interessen, diese wurden auch Zunft genannt. Jedes Handwerk hatte eine eigene Interessenvertretung (Zünfte).
Glas:
Im Mittelalter ein teures und seltenes Material. Aus diesem Grund waren Glasfenster hauptsächlich in Kirchen zu finden.
Gottesurteil:
Wichtiger Bestandteil der "Rechtsprechung" bis ins 13.Jahrhundert. Der Idee nach ging man davon aus, daß Gott auf der Seite des rechtschaffenen, unschuldigen Menschen stehe, so daß er Schaden von diesem abwenden werde. Ein Beschuldigter mußte eine Probe bestehen. Bestand er diese, befand er sich im Recht, da man davon ausging, daß Gott ihm beigestanden hatte. Verbreitete Proben waren: Zweikampfprobe, Kesselfangprobe, Feuerprobe, Wasserprobe und Kreuzprobe.
Greifeisen:
Zangenähnliches Werkzeug aus Eisen, das bei einer Belagerung von den Verteidigern am Tor herabgelassen wurde. Auf diese Weise versuchte man den Rammbock zu greifen und festzuhalten.
Griechisches Feuer:
Gemisch aus Teer, Schwefel, Harz, Salz und Kalk, das in einen Tontopf gefüllt und dann angezündet wurde. Wenn der Topf geworfen wurde, kam er beim Aufprall der Wirkung einer Brandbombe sehr nahe. Das Griechische Feuer wurde als Waffe bei Belagerungen von Festungen eingesetzt.
Grobsteinmetz:
Der Grobsteinmetz übernahm die Vorbearbeitung des Rohsteins, indem er ihn in eine Grundform brachte (z.B. Quaderform). Danach konnte er dann vom Steinmetz durch die Feinbearbeitung fertiggestellt werden. Oft übernahmen Lehrlinge oder Gesellen der Steinmetzmeister diese Arbeit.
Grundherr:
Adliger, der über ein bestimmtes Territorium herrscht.
Handfeste:
Urkunde, die vom Aussteller durch Handauflegen bekräftigt wurde. Dieser Schutzbrief sicherte Privilegien eines bestimmten Personenkreises. Bekannteste Anwendung ist die Verleihung des Stadtrechtes.
Handwerk:
Älteste Form der gewerblichen Tätigkeit. Dem Handwerksstand gehörten nur Freie an. Für jeden Handwerksberuf entwickelten sich im 12. Jh. Zünfte, d. h., daß sich der jeweilige Berufsstand in einer Interessenvereinigung zusammenschloß. Der jeweilige Berufsstand setzte sich aus den Meistern, den Gesellen und den Lehrlingen zusammen.
Die Lehrlinge erlernten das Handwerk bei einem Meister, der als einziger ausbildungsberechtigt war. Die Ausbildungszeit konnte von fünf bis zu neun Jahren andauern. Der Lehrling erhielt während dieser Zeit nur Unterkunft, Verpflegung und Kleidung, aber keinen Lohn von seinem Meister. Da Lehrstellen sehr begehrt waren, war es sogar üblich, daß die Eltern eines Lehrlings bei Ausbildungsbeginn dem Meister eine Zahlung zu leisten hatten, das sog. Lehrgeld.
Die Gesellen waren Facharbeiter, die nach bis zu neunjähriger Ausbildung als Lehrlinge diesen Rang erhielten. Gesellen erhielten einen Lohn vom Meister und hatten das Recht ihre Anstellung zu wechseln. Sie waren mit Erhalt ihres Ranges befähigt, eigenverantwortlich Arbeiten für ihren Meister zu übernehmen.
Um Meister zu werden, mußte ein Geselle all das beherrschen, was auch sein Meister konnte. Erst dann durfte er die Meisterprüfung ablegen, indem er ein sog. Meisterstück anfertigte. Bestand er die Prüfung, war er von nun an Meister, konnte selber Lehrlinge ausbilden und einen eigenen Betrieb eröffnen.
Hanf:
Aus Mittelasien stammende Pflanze, die schon im Mittelalter in Europa angebaut wurde. Aus den Fasern der zwei bis drei Meter hohen Stengel wurden Seile hergestellt. Die Pflanzensamen dienten als Mittel gegen Schmerzen.
Heraldik:
Die Heroldskunst. Wappenkunde, die im 12. – 13. Jh. entstand. Da die Ritter durch immer stärkere Rüstungen und Vollvisierhelme nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren, wurden persönliche Zeichen, die sog. Wappen eingeführt, um die Kämpfer in einer Schlacht unterscheiden zu können. Das Wappen wurde neben der Flamm auf dem Schild geführt (Wappen = Schildzeichen). Die Heraldik legte genau fest, wie ein Wappen aufgebaut sein mußte sowie welche Farben und Farbkombinationen zulässig waren. Ein Wappen bestand aus dem geometrisch aufgeteilten Hintergrund, dem sog. Heroldsbild, und einem Symbol im Vordergrund, der sog. Gemeinen Figur.
Herold:
Da die Wappen recht umfangreich aufgebaut sein konnten und zudem strengen Regeln unterworfen waren, entstand der Beruf der Herolde, die Spezialisten der Wappenkunde waren. Sie kündeten u. a. beim Turnier die Kombattanten an.
Heroldsbild:
Geometrisch aufgeteilter Hintergrund des Wappens eines Ritters.
Holzgeld:
Abgabe (Steuer) die der Leibeigene dem Grundherrn für das Sammeln von Brennholz zahlen mußte.
Honig:
Hauptsüßstoff im Mittelalter, da Zucker importiert werden mußte und somit teuer war.
Hufe:
Bezeichnug der Hofstätte (Bauernhof) einer Bauernfamilie im Mittelalter. Sie beinhaltete alles, was zum Lebensunterhalt der Familie notwendig war (Hof, Ackerland und Anteil an der Allmende.
Die Durchschnittsgröße einer Hufe lag bei etwa sieben bis zehn Hektar Land.
Indigio:
Ältester blauer Farbstoff, der aus verschiedenen trop. Pflanzen gewonnen werden kann.
Infanterie:
Oberbegriff aller zu Fuß marschierenden und kämpfenden Soldaten.
Inquisition:
Anfang des 13. Jh. institutionalisierte Ketzerverfolgung der kath. Kirche. Durch Zusammenwirken von weltlicher (Kaiser) und kirchlicher Obrigkeit (Papst) eingerichtet worden. Hartnäckige Ketzer wurden nach ihrer Schuldigsprechung gefoltert und verbrannt.
Insignien:
Herrschaftszeichen, bei den röm. – dt. Kaisern Krone, Reichsschwert, Reichsapfel und Krönungsmantel.
Investitur:
Im Mittelalter die sinnbildliche Übergabe eines Lehens an einen Vasallen oder die Übertragung der weltlichen Besitzrechte und geistlichen Befugnisse an einen Bischof/Abt.
Johannisfest:
Mhd. Sommerjohanni, Fest zur Geburt von Johannes dem Täufer am 24. Juni. Die kath. Kirche verband den Tag mit dem heidnischen Fest der Sommersonnenwende.
Julbrot:
Heidnisches Opfergebäck zum Julfest. Meist in Form von Sonnenrädern.
Julfest:
Urspr. das heidnische Hochwinterfest, Wintersonnenwende. In nord. Ländern oft noch die Bezeichnung für das Weihnachtsfest.
Junker:
Urspr. im Mittelalter die Bezeichnung von Söhnen der Mitglieder des Hochadels. Später Bezeichnung für adlige Gutsherrn und allgemeine Bez. für junge Adlige.
Kalkbrenner:
Bauhandwerker des Mittelalters. Er stellte den Mörtel für die Mauerverbindungen aus Steinen her, indem er Kalkstein zermahlte und im Ofen brannte. Dieser Zement wurde dann mit Sand und Wasser zu Mörtel verarbeitet.
Kalktünche:
Heutzutage wirkt es so, als sei die Fassade einer Burg im Mittelalter nach dem Errichten des Mauerwerks unbehandelt geblieben. Burgen wurden aber grundsätzlich mit einem Anstrich aus Kalkfarbe (Kalktünche) versehen. Dabei wurden sogar in manchen Fällen farbige Anstriche (z.B. rot) anstatt von weiß gewählt.
Kämmerer:
Angesehene Stellung eines Hofbeamten. Er war der oberste Diener des Burgherrn, dem die Leitung der Privatgemächer oblag. Die Position des Kämmerers erweiterte sich im Laufe der Jahrhunderte soweit, daß er den gesamten Haushalt und die Güter seines Herrn beaufsichtigte und verwaltete. Er war zudem Aufseher und Hüter der Schatzkammer des Herrn.
Kanzler:
Im Mittelalter meistens die höchste Stellung eines Hofbeamten unter dem Herrn. Er stellt Urkunden, Gerichtsurteile und Anordnungen des Grundherrn aus. In wichtigen Angelegenheiten war er der Stellvertreter des Grundherrn.
Kapelle:
Gebetsraum zur Ausübung des Gottesdienstes. In jeder Burg wurde eine Kapelle errichtetund sollte nach Ansicht der Geistlichkeit der höchste Raum in der Burg sein, um dem Himmel am nächsten zu sein, was aus praktischen Gründen oft vom Baumeister "übersehen" wurde.
Kaplan:
Geistliches Amt eines Priesters. Der Burgkaplan war oft ein enger Vertrauter des Burgherrn. Außer den religiösen Aufgaben übernahm er oft die schulische Ausbildung der Kinder des Burgherrn, da er zu den wenigen Personen im Mittelalters gehörte, die Lesen und Schreiben konnten. Deshalb erledigte er auch oft die Korrespondenz des Herrn, besonders, da ein Kaplan oft verschiedene Sprachen beherrschte.Der Kaplan begleitete den Herrn auch auf seinen Reisen.
Kastell:
Urspr. befestigtes röm. Heerlager. Im Mittelalter kleine Burganlage.
Kastellan:
Urspr. andere Bezeichnung für den Burgvogt.
Käse:
Hauptnahrungsmittel der armen Bevölkerung. Käse war im Mittelalter bereits ein Massenprodukt, da er einige Monate gelagert werden konnte, bot er die Möglichkeit, Milch haltbar zu machen.
Katapult:
Wurf- bzw. Schußmaschine in der Antike und im Mittelalter. Als Geschoße dienten Steine und Pfeile. Im Mittelalter wurden unterschiedliche Arten von Katapulten eingesetzt. Zum einen feuerte man Geschosse mit Hilfe eines, durch eine Sehne gespannten, großen Bogens ab und zum anderen verwendete man Wurfarme aus Holz, die mit einer Konstruktion von Seilen oder Federmechanismen verbunden waren, die bei Auslösung (z. B. Durchtrennen des gespannten Halteseils) das Geschoß wegschleuderten.
Katze:
Fahrbares Schutzhaus in Form eines Schuppens, mit dem sich die Angreifer, bei der Belagerung einer Burg, den Mauern nähern konnten, um diese zu zerstören. Die Angreifer erhielten so einen besseren Schutz vor Pfeilen oder Steinen, die von den Verteidigern auf sie hinab geworfen wurden.
Kaufleute:
siehe Fahrende Händler
Kerker:
Gefängnis, das meist unter dem Torhaus oder dem Bergfried einer Burg angelegt wurde.
Kerzen:
Neben Fackeln die am häufigsten benutzte Lichtquelle. Billigere Kerzen wurden aus Tierfett, dem sog. Talg hergestellt. Das Fett wurde erhitzt und in kochendem Wasser gereinigt. Eine Leinenschnur wurde durch den heißen Talg gezogen, dann ließ man ihn erkalten. Dies wiederholte man in mehreren Arbeitsgängen. Wachskerzen waren wesentlich teurer und wurden aus Bienenwachs hergestellt. Der Docht aus Leinen wurde Mithilfe einer Schöpfkelle immer wieder mit heißem Wachs beträufelt. Solange dieser noch warm war, konnte man die Kerze durch Rollen auf einem Holzbrett formen. Wachskerzen erzeugten ein helleres Licht als Talgkerzen und rochen auch nicht so unangenehm wie diese.
Kerzenzieher:
Handwerksstand der Kerzen herstellte.
Ketzerei:
Abgeleitet von Katharern. Als Ketzer galten Personen, welche die Lehre der Kirche in Frage stellten, oder nicht an den Inhalt der Bibel glaubten. Dies galt im Mittelalter als schweres Verbrechen und wurde mit empfindlichen Strafen bis hin zum Tod geahndet.
Knappe:
Vorstufe des Ritters. Ein junger Adliger der im Dienst eines Ritters steht. Er ist dessen Gehilfe und Lehrling. Er betreute das Pferd, die Ausrüstung und Rüstung des Ritters. Zu seinen Aufgaben gehörte es, dem Ritter in die Rüstung zu helfen, ihn in die Schlacht zu begleiten, ihn bei Tisch zu bedienen oder als sein Bote aufzutreten. Mit 14 Jahren begann die Ausbildung und endete normalerweise damit, daß der Knappe selber mit 21 Jahren in den Ritterstand erhoben wurde. Der Knappe wurde in dieser Zeit von seinem Ritter beschützt sowie im Reiten und Waffenhandwerk ausgebildet, aber auch in höfischer Etikette unterrichtet.
Krämer:
Begriff für Fahrende Händler oder Kaufleute.
Kronvasallen:
Vasallen (s. Lehen) eines Königs oder Kaisers. Normalerweise Herzöge oder Grafen.
Latrine:
Bezeichnung der Toilette. Mit Wasser aus einem Tank unter dem Dach, der das Regenwasser auffing, wurden die Fäkalien durch den sog. Latrinenschacht in den Wassergraben oder eine Jauchegrube gespült. Reichere Personen saßen auf einem Holzsitz, und ließen den Latrinenraum an einer Seite des Kamins errichten, so daß er im Winter beheizt war.
Lederer:
siehe Gerber.
Lehen:
Vom Lehnsherrn an den Lehnsmann gegen Dienst und Treue verliehenes Land und/oder Amt.
Der Lehnsherr überträgt dem Lehnsmann (auch Vasall genannt) die Nutzungsrechte, nicht aber die Eigentumsrechte an dem Gut. Der Lehnsmann verpflichtet sich dafür zum Kriegsdienst für seinem Lehnsherrn. Unterschieden wurde zwischen "Schenkung des Lehens" und dem "Erblehen". Die Schenkung sicherte dem Vasallen die Rechte nur auf Lebenszeit. Das erblichen Lehen hingegen garantierte auch den Nachkommen des ersten Erblehensträgers die Nutzungsrechte am Lehen. Der Vasall übt auf dem Lehen stellvertretend die volle Herrschaft in allen Angelegenheiten aus.
Lehnswesen:
Staats– und Gesellschaftsordnung des Mittelalters. Es besteht aus der Vasallität und dem Benefizium zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann. Die Vasallität entstand aus dem germanischen Gefolgschaftswesen, das ein Treueverhältnis zwischen Herrn und Gefolgsmann bezeichnete. Der Herr gewährte Schutz und Unterhalt, der Gefolgsmann versprach lebenslangen Gehorsam und Dienst.
Das Benefizium beschreibt die Ausstattung des Vasallen/Lehnsmann mit einem Lehen, meist Land, das dem Vasall zum Unterhalt dient. Mit Ausnahme des Königs, ist jeder der Vasall eines anderen, da die direkten Vasallen des Königs (s. Kronvasalen) ihrerseits wieder andere Adlige belehnen (usw.). Somit ist die Gesellschaftsstruktur mit einer Pyramide vergleichbar, an deren Spitze der König steht.
Lehrling:
siehe Handwerk.
Leibdiener:
Hohe Adlige hatten einen persönlichen Diener, den sog. Leibdiener, der sich ausschließlich um seinen Herrn kümmerte. Er war für den Schutz des Herrn zuständig und schlief deshalb sogar im selben Gemach wie wie dieser. Als besondere Gunst seines Herrn, trug der Leibdiener in vielen Fällen die abgelegten Kleider seines Herrn, so daß für Fremde eine Verwechslung des Dieners mit einem Adligen durchaus vorkommen konnte.
Leibeigener:
Unfreie Person, die von ihrem Herrn persönlich abhängig ist. Anders als bei der Sklaverei war der Leibeigene nicht Eigentum des Herrn, dieser hatte aber die absolute Rechtshoheit über ihn. Der Herr bestimmte über den Aufenthaltsort und die Arbeitskraft des Untergebenen. Darüber hinaus mußte er einer Heirat des Leibeigenen zustimmen.
Leinen:
Auch Leinwand oder Linnen genannt. Stoff, der aus den Fasern (Flachsfasergarn) der Flachspflanze hergestellt wird. Da Wolle kratzte, trug man Leinen gerne als Unterwäsche. Im Mittelalter war es allerdings teuer, da die Herstellung sehr aufwendig war.
Luder:
Köder, den der Falkner an einer Leine über dem Kopf schwingt, um den Raubvogel nach der Jagd auf den Handschuh zurückzulocken.
Mahlzins:
Steuer, Getreide mußte in der Mühle des Grundherrn gemahlen werden. Dieser erhielt dafür einen Mahlzins, der meist direkt durch Abgabe eines Teils des Korns beglichen wurde. Getreide selber zu mahlen war verboten.
Mannsloch:
Tür, die in die größeren Tore eingelassen wurde. Durch das Mannsloch gelangte jeweils nur eine Person nach der anderen in das Innere des Burghofs. Dies erleichterte den Wachen ihre Aufgabe, da sie das Haupttor geschlossen halten konnten, denn einzelne Personen passierten durch die eingelassen Tür.
Marstall:
Von reichen Adligen reserviertes Gebäude, indem Jagdfalken aufgezogen und gepflegt wurden.
Maschikulis:
Gußöffnungen im Boden eines Wehrgangs durch welche Belagerer einer Burg mit heißem Wasser, Pech oder siedendem Öl überschüttet werden konnten.
Mastzins:
Steuer, die der Grundherr dafür erhob, daß die Schweine seiner Bauern im Wald nach Bucheckern und Eicheln suchen durften. Die Haltung der Tiere war für den Bauern aber günstig, da sie nicht gefüttert werden mußten.
Meister:
siehe Handwerk.
Meisterstück:
siehe Handwerk.
Mietzins:
Steuer des Grundherrn, die ihm der Leibeigene für die Nutzung einer Hütte zu zahlen hatte.
Minnesang:
Seit ca. 1200 A. D. bekannte Form der Liebeslyrik. Es handelte sich dabei immer um Gesang. Die Minne beschrieb mit künstlerischen Ausdruck die idealisierte Form der Liebe zwischen einer Edeldame und einem Ritter.
Minnesänger:
Dichter, Komponist und Sänger, der die ritterlichen Tugenden, vor allem aber die Minne lobpreist. Gehört meistens dem ritterlichen Stand an.
Mohn:
Der Milchsaft des Mohns diente im Mittelalter als Schmerz– und Schlafmittel.
Mordlöcher:
Löcher im Dach der Tordurchfahrt, durch die Pfeile auf Eindringlinge abgefeuert wurden, nachdem man diese durch das Schließen der Fallgater eingesperrt hatte.
Mörser:
Runde Steinschale in der man mit Hilfe eines Stößels Kräuter oder Gewürze zerrieb.
Mörtel:
Bereits im Mittelalter bekannte Mischung aus Sand, Wasser und gebranntem Kalk mit der gemauert wurde.
Mundschenk:
Hofbeamter, der die Aufsicht über die Weinkeller und Weinberge führte. Ihm unterstanden die Bierbrauer, die Kellerer, aber auch die Einschenker, die an der Tafel des Herrn dienten.
Nagel:
War eins der wichtigsten Handwerkerutensilien im Mittelalter. Nägel wurden vom Schmied hergestellt und vielseitig verwendet, da Schrauben unbekannt waren. Ihr Verwendungsgebiet umfaßte z.B. den Hausbau, die Möbelherstellung und das Beschlagen von Pferden mit Hufeisen.
Narr:
Auch Hofnarr genannt, gehörte nicht zum fahrenden Volk der Gaukler und Spielleute, sondern war bei Hof angestellt. Seine Aufgabe bestand darin, auf Festen den eigenen Herrn und dessen Gäste durch Späße zu unterhalten. Dem Hofnarr stand es frei sich selbst über wichtige Personen lustig zu machen und von Dingen zu reden, über die sonst niemand zu sprechen wagte. Er trug bunte Kleidung und eine Schellenkappe. Außerdem hielt er ein Narrenzepter, die sog. Marotte in den Händen.
Neumen:
Notenschrift aus dem frühen Mittelalter, die im Zeitraum vom 8. – 11. Jh. benutzt wurde. Der Melodieverlauf wird in Form von Punkten, Strichen und Haken über den Textworten des Lieds angezeigt. Genaue Tonhöhe und Tondauer lassen sich noch nicht mit ihnen ausdrücken.
Ochse:
Kastriertes männliches Rind. Wurde als Arbeitstier benutzt, das den Pflug oder Karren zog.
Operation:
Operationen wurden auch im Mittelalter durchgeführt. Diese übernahm jedoch im Normalfall nicht der Arzt, sondern der Bader. Da Bakterien zu der Zeit unbekannt waren, bedeutete die fehlende Hygiene ein hohes Risiko für den Erkrankten. Meist wurden Operationen erst als letztes Mittel angewendet und die häufigste Anwendung fanden sie in der Amputation.
Oubliette:
War ein dem Kerkerraum angeschlossener kleiner Raum, indem Gefangene eingesperrt wurden, deren Tod man erreichen wollte. Das Wort leite sich vom frz. oublier (vergessen) ab.
Page:
Junger Adliger, der meist mit sieben Jahren sein Heim verließ, um an einem fremden Hof zu dienen und dort ausgebildet zu werden. Auf dem anderen Gut erlernte er dann Lesen und Schreiben sowie die höfischen Sitten, erhielt aber auch Unterricht im Waffenhandwerk und Reiten. Mit dem 14. Lebensjahr konnte er dann von einem Ritter in den Knappenstand aufgenommen werden.
Palas:
Hauptwohngebäude in einer Burg. Es beinhaltete die Gemächer des Burgherrn und der hochgestellten Personen der Burg sowie den Festsaal und die Kellerräume, in denen die Vorräte gelagert wurden.
Patrizier:
Urspr. Adeliger des Römischen Reichs. Im Mittelalter wurden Mitglieder des reichen Bürgertums der Städte als Patrizier bezeichnet.
Pech:
Rückstand der bei der Destillation von Stein–, Braun– oder Holzkohle entsteht. Die zähe schwarzbraune Masse ist brennbar und wurde als Verteidigungsmittel einer Burg eingesetzt, indem man sie in heißem Zustand von oben auf den Angreifer schüttete und eventuell sogar entzündete. Pech wurde auch vom Angreifer bei der Herstellung des sog. griechischen Feuer verwendet.
Pergament:
Ungegerbte, enthaarte Tierhaut, die vor der Einführung des Papiers verwendet wurde.
Pfalz:
Burgähnliche Anlage, die zur zeitweiligen Beherbergung und Hofhaltung der fränk. und dt. Könige diente (sog. Königs– oder Kaiserpfalzen).
Pferdezins:
Steuer des Grundherrn, die der Leibeigene zu entrichten hatte, wenn er ein Pferd als Arbeitstier besaß.
Piscina:
Kleines Waschbecken in der Kapelle, in dem der für das Abendmahl benutzte Kelch gereinigt wurde.
Pranger:
Schandpfahl. Ein Holzpfahl, an dem Verbrecher öffentlich ausgestellt wurden. Später benutzte man auch ein Gestell aus Holz, in dem Kopf und Hände des Verbrechers eingeklemmt wurden. Der Pranger war eine Strafe für leichte Straftaten wie Lügen, Gerüchte verbreiten oder wenn jemand etwas mit falscher Gewichtsangabe verkaufte.
Quaderstein:
Naturstein, der vom Steinmetz und Grobsteinmetz rechteckig gehauen wurde und als Baumaterial diente.
Rammbock:
Holzstamm, der von Soldaten getragen wird, um damit das Tor einer Festung einzurammen. Große Rammböcke wurden sogar an fahrbaren Holzrahmen mit Seilen aufgehängt, so daß sie mit großer Wucht vor und zurück geschwenkt werden konnten. Der vordere Teil des Rammbocks wurde auch mit Eisen verkleidet, um ihn stabiler zu machen.
Raubvögel:
Verschiedene Arten von Raubvögeln wurden zur Beizjagd eingesetzt. Traditionell wurden bestimmte Vogelarten bestimmten Adelsrängen zugeordnet:
Adler, Wanderfalke – Kaiser, Könige und Prinzen
Habicht – Ritterschaft
Zwergfalke – Damen des Adels
Sperber – Klerus
Turmfalke – Knappen und Pagen.
Reet:
Die günstigste Art ein Dach zu decken bestand darin, es mit Reet auszulegen. Reet bezeichnet ein Bündel aus Pflanzenhalmen, wobei die Art der Halme davon abhängig war, was sich in der jeweiligen Umgebung finden ließ. Typischerweise wurde Stroh, Schilfrohr oder Ginster benutzt. Die Bündel, genannt Schoofe, wurden auf dem Dachbalken festgeklopft und mit Haselnußbaumruten daran festgebunden. Dieses wasserdichte Dach hielt bis zu 50 Jahre.
Reliquien:
Gebeine eines Heiligen. Bezeichnet aber ebenso die Gegenstände eines Heiligen, die sich zu dessen Lebzeiten in seinem Besitz befanden. Im Mittelalter wurden Schwüre auf Reliquien geleistet, um deren Bedeutung zu demonstrieren.
Richter:
Das Richteramt wurde im Mittelalter von den Adligen ausgeübt. Dem Ritter obliegt die Pflicht, auf seinem Lehen stellvertretend für den Lehnsherrn Recht zu sprechen. Dabei war er Richter, Polizist und Schöffe in einem. Ritter konnten normalerweise aber nur niederes Recht sprechen, d. h. Urteil fällen, die nicht mit dem Tod geahndet wurden. Demgegenüber fällte der hohe Adlige die Urteile des höheren Rechts, er war also auch berechtigt Todesurteile zu verhängen. Straftaten, die mit dem Tod bestraft wurden, waren Verrat, Mord, Vergewaltigung einer Adligen und Diebstahl des Eigentums eines Adligen.
Ritter:
Adelsstand des Mittelalters, der aus den berittenen, gerüsteten Kriegern hervorging. Das Rittertum basierte auf der Gesellschaftsform des Feudalismus. Diese Gesellschaftsform beinhaltete vor allem den Grundzug, daß sich eine Person, der sog. Lehnsmann oder Vasall freiwillig einem höhergestellten sog. Lehnsherrn verpflichtete. Der Ritter stand also im Dienste eines anderen Adligen und erhielt von diesem Schutz, Unterkunft und Verpflegung. Im Gegenzug leistete der Ritter seinem Lehnsherren militärischen Dienst, verteidigte dessen Ehre und Ruf, sprach Recht für ihn und beriet ihn in wichtigen Angelegenheiten. Der Lehnsherr stattete seinen Lehnsmann meist mit dem sog. Benefizium aus, d. h. der Lehnsmann erhielt ein Lehen, um seinen Unterhalt zu gewährleisten. Somit oblagen dem Ritter die Verwaltungsaufgaben auf dem Land, das er für seinen Herrn hielt. Diese gesellschaftliche und rechtliche Verbindung wurde durch eine öffentliche Zeremonie, dem Schwur des Lehnseid, bekanntgegeben. Durch diesen Schwur wurde ein unverbrüchliches ewiges Band der Gefolgschaft zwischen den beiden Personen geschlossen, die aus der germanischen Tradition des Gefolgschaftswesen entstanden war.
Nach dem Ableisten der gegenseitigen Treueschwüre, war der Vasall "eines anderen Mann", oder wurde auch als "Mann von Hand und Mund" bezeichnet.
Um in den Stand eines Ritters erhoben werden zu können, mußte ein genau vorbestimmter Lebensweg beschritten werden. Der angehende Ritter hatte zuerst als Page und danach als Knappe seine Befähigung zum Ritter unter Beweis zu stellen. Wurde er als würdig empfunden, erhob ein höhergestellter Adliger ihn im Alter von ca. 21 Jahren durch das Ritual der Schwertleite, seit dem 13. Jh. ersetzt durch den Ritterschlag, in den Ritterstand.Dem Ritter oblag nicht nur die Ausübung des Kriegshandwerks, sondern sein Stand übernahm im Laufe der Jahrhunderte in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion, die das Edle im Menschen charakterisierte. Der Ritter wurde zur Verkörperung des Guten im Menschen und sollte bestimmten Tugenden folgen, die den anderen Gesellschaftsschichten als Verhaltensvorgabe dienen sollten. Zu diesen Tugenden gehörten vor allem Treue, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Gnade und der Schutz der Schwachen. Der Ritter sollte ebenfalls im Sinne der Kirche den Wahren Glauben beschützen.
Rotte:
Auch Scharen genannt. Kleinste Abteilung von Soldaten eines mittelalterlichen Heeres. Ihre Größe richtete sich nach Rang und Einkommen ihres Anführers, dem ranghöchsten Ritter der Gruppe. Der Rotte gehören nicht nur Ritter, sondern auch Knappen, berittene Soldaten sowie Bogenschützen und Knechte an.
Runen:
Germanische Schriftzeichen, die hauptsächlich für Inschriften benutzt wurden. Sie bestanden zuerst aus einem Alphabet von 24 Zeichen, dem sog. Futhark. Diese wurde später von den Angelsachsen auf 28 Zeichen erweitert.
Rüstkammer:
Raum, in dem Waffen, Rüstungen und anderes Kriegsgerät aufbewahrt wurden.
Säckelschneider:
Mittelalterliche Bezeichnung des heutigen Taschendiebes. Da Hosentaschen im Mittelalter nicht bekannt waren, trug man sein Geld in einem kleinen Beutel am Gürtel. Der Dieb schnitt diesen im Marktgetümmel mit einem Messer ab, daher die Bezeichnung "Säckelschneider".
Salzfaß:
Mittelalterliche Speisen wurden meist nicht gesalzen serviert. Auf der Tafel stand vor dem Gastgeber ein Salzfaß, dies sollte seinen Wohlstand unterstreichen. Die Ehrengäste saßen am Tisch des Gastgebers, was auch "über dem Salz sitzen" genannt wurde. Die weniger wichtigen Personen setzte man an die unteren Tische, sie saßen somit "unter dem Salz".
Schach:
Vermutlich ein in Indien im 6. Jh. entstandenes Strategiespiel. Seit dem 11. Jh. in Europa bekannt und sehr beliebt im Mittelalter.
Schafwolle:
Wichtigster Wollstoff des Mittelalters in Europa, da Baumwolle importiert werden mußte. Die gesellschaftliche Unterschicht trug fast ausschließlich Kleider aus Schafwolle.
Schatzkammer:
Raum einer Burg oder Festung, in dem die Wertgegenstände, vor allem Gold und Silbermünzen des Burgherrn aufbewahrt wurden. Der Kämmerer trug die Verantwortung für die Schatzkammer.
Schildgeld:
Im späten Mittelalter die Möglichkeit eines Lehnsmanns, sich vom Kriegsdienst bei seinem Herrn "freizukaufen". Mit dem Geld, das der Lehnsmann bezahlte, wurden Söldner angeworben.
Schindeln:
Kleine Holzbretter, die zum Dachdecken benutzt wurden. In Form, Größe und Anwendung unseren heutigen Dachpfannen sehr ähnlich.
Schindeldächer waren besser zu reparieren als Dächer aus Reet, da einzelne Schindeln leichter ausgetauscht werden konnten. Die Haltbarkeit war jedoch wesentlich geringer, da das Holz durch die Nässe nach und nach verfaulte.
Schoofe:
Bündel aus Pflanzenhalmen (Stroh oder Schilf), die zu einem Dach aus Reet zusammengebunden wurden.
Schultheiß:
Auch Schulze genannt. Dorfpolizist, der dem Stand der Bauern angehörte und auch von ihnen selbst gewählt wurde. Er ersetzte oft den Büttel und überwachte die Arbeit der Bauern, sammelte die Steuern für den Grundherrn ein, und meldete ihm jegliche Gesetzesübertretung auf dessen Lehen.
Schürenzins:
Auch Frauengeld genannt. Der Grundherr mußte einer Heirat zwischen Leibeigenen zustimmen.
Wurde der Maid die Unschuld vorher geraubt und das Paar dabei entdeckt, so hatte der Mann dem Grundherrn eine meist sehr hohe Strafe, den Schürenzins, zu bezahlen, der leicht mehrere Tagelöhne umfassen konnte.
Schwarzer Tod:
Bezeichnung für die Pest, da sich am Körper des Erkrankten zuerst schwarze Flecken bilden, die dann zu Eiterbeulen anschwellen.
Seife:
Der arme Teil der Bevölkerung benutzte eine Mischung von Asche und Tierfett als Seife. Diese wurde aufgrund ihres unangenehmen Geruchs aber nur zur Reinigung der Wäsche verwendet.
Reiche Personen ließen sich Seifen aus dem Ausland kommen, die unseren heutigen Seifen sehr ähnlich waren. Aus Südeuropa kamen beispielsweise wohlduftende Seifen, die mit Hilfe von Olivenöl hergestellt wurden. Die damaligen Seifen hatten allerdings nicht die uns heute bekannte feste Form, sondern eher die Beschaffenheit einer Paste.
Siegel:
Ein persönliches Prägezeichen eines Adligen, das zur Beglaubigung eines Schriftstücks verwendet wurde. Das Siegel, das meist aus Metall hergestellt wurde, konnte auf dem Schriftstück in Wachs oder Siegellack eingeprägt werden. Siegellack wurde meist aus Fichtenharz hergestellt. Ein Dokument bekam nur durch dieses Siegel Gültigkeit, da eine Unterschrift im heutigen Sinne bedeutungslos war. Da das Siegel ein wichtiges Beweisstück für die Echtheit eines Dokumentes war, wurde es sorgfältig verwahrt, meist persönlich vom Kanzler. Das Siegel eines Adligen spiegelte normalerweise sein persönliches Wappen wieder.
Skorbut:
Eine im Mittelalter häufig vorkommende Krankheit, die aufgrund eines Vitamin–C–Mangels entsteht. Da gegen Ende des Winters die meisten Menschen im Mittelalter ohne Obst und Gemüse auskommen mußten, war die Krankheit sehr oft vertreten. Anzeichen für Skorbut sind Mattigkeit, Muskelschwäche und Zahnverlust.
Söldner:
Im späten Mittelalter bestanden die Heere zu immer größeren Teilen aus bezahlten d. h. für Sold dienenden Soldaten. Da es den Rittern möglich war, sich vom Kriegsdienst bei ihrem Herrn durch das sog. Schildgeld freizukaufen, warb der Lehnsherr oder der Söldnerführer (Condottiere) Männer an, die für Geld kämpften. Diese fühlten sich, anders als die Gefolgsleute der Lehnsherrn nur dem verpflichtet, der sie bezahlte. Sie interessierten sich nicht für Ruhm und Ehre. Oft wurden sie auch nach einem Feldzug weiterhin bezahlt, da sie sich ansonsten in Söldnerbanden zusammenschlossen und raubend, plündernd und mordend durch die Ländereien desjenigen zogen, der sie bis vor kurzem noch bezahlt hatte. Ablösesummen wurden ihnen gezahlt, um sie dazu zu bewegen in Nachbarländer weiterzuziehen.
Stechpuppe:
Übungsgerät für berittene Krieger bei der (s.) Tjost. Mit einer Lanze versuchte man das Ziel, meistens ein Schild an einem Holzpfahl, aus vollem Galopp zu treffen. Im späteren Mittelalter wurde das Schild an einem drehbaren Querbalken befestigt, an dessen anderem Ende befand sich ein Sandsack, der den Reiter vom Pferd warf, wenn er nicht schnell genug ritt. Dies erhöhte den Schwierigkeitsgrad der Übung und verlangte eine höhereGeschicklichkeit.
Steigbügel:
Metallbügel an Riemen zu beiden Seiten des Sattels. Sie dienen dem Reiter als Fußstütze und ermöglichen eine bessere Kontrolle über das Pferd. Steigbügel sind etwa seit dem 7. Jh. in Europa bekannt und revolutionierten den berittenen Kampf Mann gegen Mann. Erst mit Einführung dieser Reithilfe war es möglich mit schweren Lanzen (im Gegensatz zu den von röm. Reiterabteilungen benutzten Speeren) vom Pferd aus anzugreifen, da sie dem Reiter einen festeren Halt ermöglichten, damit dieser die Stoßkraft beim Aufeinandertreffen der Kombattanten besser abfangen konnte.
Steinmetz:
Handwerker, der den natürlichen Stein mit Hammer und Meißel bearbeitet und sie für den Bau in die gewünschte Form bringt.
Steinvorrat:
Auf Burgen wurde ein Steinvorrat angelegt, der bei einer Belagerung als Wurfmaterial diente. Durch die Höhe der Burgmauern konnte ein, auf einen Angreifer fallengelassener, großer Stein tödlich sein.
Steuern:
Zwangsabgabe die alle Einwohner eines Gebietes ihrem Herrn zu entrichten hatten. Die Vielfalt der Steuern war im Mittelalter außerordentlich.
Strafen:
Viele Arten von Strafen im Mittelalter sollten die Tat des Verbrechens widerspiegeln. So wurden Gotteslästerer beispielsweise mit dem Herausschneiden der Zunge bestraft. Die Bestrafung ging von einfachen Geldstrafen, über Entehrung (Ächtung, Pranger) bis hin zu Leibesstrafen (Verstümmelungen des Körpers) oder der Todesstrafe.
Wurzeln, Kräuter und ihre Wirkung
Die hier vorgestellten Pflanzen wachsen auch in unserem Klima. Sie fallen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz (BtmG). Trotzdem ist es nicht ohne Risiko, mit diesen Pflanzen auf eigene Faust herumzuexperimentieren. Sie können sowohl Rauschzustände als auch gesundheitliche Schäden verursachen.
Näheres zu den Nebenwirkungen kannst Du den jeweiligen Beschreibungen entnehmen.
Alraune
Mandragorum Officinarum
Vorkommen
Die Alraune wächst auf Feldern und auf steinigen Plätzen. Sie ist hauptsächlich in Südeuropa vertreten.
Wirkung
Die Wurzel wird zerkleinert und daraus ein Aufguß hergestellt.
Die Wirkung ist halluzinogen gefolgt von Trancezuständen oder Schlaf. Es kann zu sexuellen Enthemmungen kommen.
Nebenwirkungen
Die Dosierung ist sehr heikel, da Alraune auf jeden Organismus individuell wirkt. Oft treten Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen und Durchfall auf. Das Gift der Pflanze wirkt auf den Kreislauf und kann bei zu starker Dosierung zu Herzinfarkt führen.
Bilsenkraut
Hyoscyamus niger
Vorkommen
Bilsenkraut wächst insbesondere in sandigen Gebieten, auf Schuttplätzen und an Straßenrändern. Wild wächst es vor allem in Südeuropa.
Wirkung
Bätter und Samen der Pflanze werden geraucht. Eine Salbe wird hergestellt, indem man Pflanzenteile bei gemäßigter Temperatur in Schweineschmalz auskocht.
Bilsenkraut wirkt narkotisch und halluzinogen. In der ersten Phase kommt es zu einem Erregunszustand, in der zweiten Phase oft zu einem narkotisch tiefen Schlaf. Während des Schlafes werden halluzinogene und sexuell gefärbte Träume erlebt.
Nebenwirkungen
Bilsenkraut ist giftig. eine Überdosis kann zum Tod führen. Insbesondere von einer wiederholten Anwendung in kurzen Abständen ist dringend abzuraten. Nach der Einnahme kommt es am nächsten Tag meist zu einem katerähnlichen Vergiftungsgefühl.
Fliegenpilz
Amanita Muskaria
Vorkommen
Roter Hut mit weißen Tupfen. Der Fliegenpilz wächst in Nadelwäldern gemäßigter Zonen.
Wirkung
Die Pilze werden bei etwa 50°C getrocknet. Eine geringe Menge wird oral eingenommen. Es ist auch möglich, die abgezogene Huthaut des Pilzes zu rauchen.
Je nach Fundort und Dosis sind die Wirkungen des Fliegenpilzes sehr unterschiedlich. Meist tritt insbesondere anfangs eine starke Übelkeit auf. Berichten zufolfe kommt es zu farbige Visionen und einer erhöhten Aufnahmefähigkeit für Geräusche. Der Rauschzustand hält etwa fünf bis sechs Stunden an.
Nebenwirkungen
Die Wirkung des Pilzes ist individuell verschieden, darum gibt es keine zuverlässigen Angaben über eine ungefährliche Dosierung. Eine Überdosis wirkt tödlich. Sehr häuftig treten Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf.
Stechapfel
Datura Stramonium
Vorkommen
Einjähriges Kraut mit glockenförmigen Blüten und stacheligen Samenkapseln. Man findet Stechapfel meist auf Schutt- oder anderen trockenen Plätzen.
Wirkung
Die Blätter der Pflanze werden geraucht.
Stechapfel wirkt halluzinogen und hypnotisch. Das enthaltene Scolopamin lähmt den Willen, die Berauschten sind darum sehr leicht beeinflußbar. Nach kurzer Zeit kommt es zu einem narkotisch tiefen Schlaf. In den Träumen während dieses Schlafes werden Berichten zufolge oft Verwandlungen in Tiere und sexuelle Visionen erlebt.
Nebenwirkungen
Bei falscher Dosierung kann es zu Todesfällen kommen. Darum ist vom Gebrauch von Stechapfel dringend abzuraten. Es treten Herzklopfen, Mundtrockenheit, Sehstörungen und meist eine starke Übelkeit auf.
Tollkirsche
Atropa Belladonna
Vorkommen
Die Tollkirsche wächst in Mittel- und Südeuropa und in Teilen Asiens und Afrikas. Zu finden ist sie an Waldlichtungen, insbesondere in bergigen und hügeligen Lagen.
Wirkung
Geringe Mengen (20 - 180 mg) der getrockneten Pflanzenblätter werden geschluckt oder geraucht.
Starkes Halluzinogen, beschleunigter Herzschlag. Der Rausch beginnt mit einer starken Erregung, meist kommt es zu angenehmen Halluzinationen. In der zweiten Rauschphase schläft man meist ein. Die Träume während dieses Schlafes werden als überaus farbig und angenehm beschrieben; oft haben sie sexuellen Charakter.
Nebenwirkungen
Von Selbstversuchen mit der Tollkirsche ist dringend abzuraten, sie ist für Menschen giftig und es sind zahlreiche Todesfälle verbürgt. Insbesondere während der anfängichen Erregungsphase kann es zu Herzanfällen kommen. Die Wurzeln der Pflanze sollten auf keinen Fall verwendet werden, da sie das hochgiftige Apoatropin enthalten.
Was ein Schwert kann und was nicht
StartFragment --> Helm-Entwicklung im Laufe der Zeit
Wie auf dem Bild zu sehen lässt sich die Entwicklung verschiedener Helmformen zeitlich gut eingrenzen. Im rechten Gang verwandelt sich der einfache Nasalhelm zu einer Barbiere mit komplettem Gesichtsschutz (1200). Im 13. Jhdt. wurde zusätzlich der Nacken geschützt bis wir um 1300 die komplette Topfhelm-Form erkennen können. Topfhelme wurden oft so angefertigt, dass Augenpartie und Verzierung ein Kreuz bildeten. Der mittlere Gang zeigt klar wie sich der Nasalhelm zu einem kompletten Kopfschutz erweitert. Mitte des 13. Jahrhunderts kennt man 2 Versionen, den Schutz mit Kette sowie mit Visier. In Zusammenlegung mit den Topfhelmen wurden daraus die späteren Visierhelme. Im linken Gang erkennt man die Abwandlung des Nasalhelms zu einem einfachen Eisenhut. Er schützte den Kopf und durch seine Breite Form konnten schläge gut abprallen. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde der Eisenhut teils verziert. Vernietungen auf dem Helm bildeten oft eine Kreuzform.

Für was steht die Abkürzung "LARP"?
LARP ist die Abkürzung für Liverollenspiel, oder besser gesagt für Live Action RolePlay oder auch Live Acting RolePlay. Manchmal findet man auch die Abkürzungen LRS (LiveRollenSpiel) und besonders in der englischen Literatur LRP (Live RolePlay)
Für was steht die Abkürzung "Con"?
Wenn Leute von einem LARP reden, hört man oft den Begriff "Con". Das steht für das englische "convention", zu deutsch "Treffen". In der Rollenspielszene hat sich der Begriff "Con" für ein Treffen eingebürgert, an dem sich viele Leute treffen um zu spielen, dementsprechend bedeutet Con im Zusammenhang mit LARP nichts anderes als das Liverollenspiel an für sich, d.h. "Ich gehe auf einen Con" ist ein Synonym für "Ich gehe auf ein Liverollenspiel". Übrigens: Obwohl man "Ich gehe auf DIE convention" sagt, hat sich für die Kurzform "Con" eigentlich eher der männliche Artikel, also DER Con durchgesetzt. Fragt mich aber bitte nicht warum...
Was ist ein Live-Rollenspiel?
Erst einmal (und wer hätte das gedacht) ist Liverollenspiel ein Spiel. Im Grunde genommen ist es eine Art "Cowboy und Indianer" für Erwachsene. Wohl jeder hat sich als Kind mal eine Kriegsbemalung ins Gesicht gemalt, eine Feder in das Haar gesteckt und ist dann als "Häuptling Adlerauge" mit Freunden im Garten auf Kriegspfad herumgeschlichen. Und wenn man will, kann man das eigentlich schon als ein Liverollenspiel betrachten, denn eben darum geht es bei einem LARP. Man schlüpft in die Rolle einer anderen Person, sei es nun in die eines Indianerhäuptlings oder eines edlen Ritters der Tafelrunde, und versetzt sich, zusammen mit anderen Spielern, in diese Phantasiewelt um dort Abenteuer zu erleben. Und da wir ja mittlerweile alle schon etwas größere "Kinder" sind, wird das ganze dann auch etwas größer aufgezogen. Anstatt der Feder im Haar ziehen wir uns selbstgemachte oder gekaufte Kostüme ("Gewandungen") an, und anstatt des Gartens wird z.B. eine echte Burg angemietet. Außerdem spielen an so einem LARP oft weit über 100 Leute mit, und die meisten Liverollenspiele dauern mehrere Tage (z.B. ein Wochenende).
Normalerweise ist es so, daß Liverollenspiele in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt im Stil von Tolkiens "Der Herr der Ringe" spielen, also mit Rittern, Königen, Magiern, Hexen, Monstern, Elfen, Zwergen und was sonst noch alles dazugehört. Es gibt zwar auch Liverollenspiele, die in anderen Genres spielen (z.B. Cyberpunk oder Vampire) aber das ist eher die Minderheit gegenüber den Fantasy-LARPs.
Um was geht es bei einem Live-Rollenspiel? Wer gewinnt? Was ist das Ziel?
Ein "Ziel" wie z.B. bei einem normalen Brettspiel gibt es beim LARP nicht. Jeder, der an einem LARP teilnimmt, hat irgendwo seine eigenen Ziele. Der Eine sucht z.B. irgend ein besonderes Schwert, der Nächste such Jemanden, der ihn in die Künste der Magie einweiht und der Dritte ist glücklich und zufrieden, wenn er bei einem Krug Met in der Taverne sitzen und den Barden beim Singen zuhören kann. Zwar gibt es auf den meisten Liverollenspielen auch ein mehr oder weniger von der Spielleitung vorgegebenes Ziel (z.B. muß eine Prinzessin aus den Händen einer Räuberbande befreit werden), in wieweit sich die einzelnen Spieler aber um dieses spezielle Ziel kümmern, bleibt jedem selbst überlassen. Zusammengefaßt kann man also sagen, daß es beim LARP kein eindeutiges Ziel gibt, außer vielleicht, eine schöne Zeit in einer Welt voller Rätsel und Abenteurer zu verbringen und dort zusammen mit den anderen Spielern viel Spaß zu haben. Deshalb kann man auch nicht sagen, daß es bei einem Liverollenspieler Gewinner oder Verlierer gibt. Natürlich.. wenn die Spieler es am Ende geschafft haben, die jungfräuliche Prinzessin aus den Händen des bösen Räubers zu befreien, dann sind sie in gewisser Weise der Sieger, aber im Endeffekt ist das nicht das Wichtige. Wer nach dem LARP nach Hause fährt und dort eine schöne Zeit hatte, der ist auf jeden Fall ein Sieger, wie auch immer das LARP im Endeffekt ausgegangen ist.
Wie läuft ein LARP im allgemeinen ab?
Am Anfang eines jeden LARPs müssen sich alls Mitspieler bei der Spiellleitung (SL) einchecken. Dort wird dann überprüft, ob der Teilnehmer seine Teilnahmegebühr (Conbeitrag) bezahlt hat, die Spielleitung teilt ihm mit, ob seine Zaubersprüche usw. genemigt wurden usw. Außerdem wird vor dem Beginn eines LARPs ein Waffencheck durchgeführt. Dabei werden von der Spielleitung (oder deren Gehilfen) alle Polsterwaffen der Mitspieler auf Sicherheitsmängel überprüft und notfalls aus dem Verkehr gezogen. Nachdem alle Mitspieler ihre Zelte/Zimmer bezogen und sich ihre Gewandungen angezogen haben, erfolgt meistens eine kurze Ansprache der Spielleitung, in der kurz die wichtigsten Regeln und Sicherheitshinweise erläutert werden. Danach beginnt das eigentliche Liverollenspiel und die Teilnehmer sind ab nun "Time In", d.h. im Spiel. Am Ende des LARPs beendet die Spielleitung dann das Spiel durch ein "Time Out" bzw. läßt es einfach langsam auslaufen.
Welche Leute machen bei einem LARP mit?
Das Durchschnittsalter der Liverollenspieler dürfte wohl irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren liegen, wobei der Frauenanteil auf den meisten LARPs etwas niedriger als der Männeranteil ist. Bei den meisten Liverollenspielen beträgt das Mindestalter 16 oder 18 Jahre, nach oben sind aber keine Grenzen gesetzt und es kommt durchaus auch oft vor, daß mehrere Generationen auf einem LARP vertreten sind.
Wer veranstaltet Live-Rollenspiele? Wie kann ich an einem Teilnehmen?
Es gibt in Deutschland eine ganze Menge LARP-Vereine und privater Gruppen die LARPs veranstalten, so daß mittlerweile eigentlich jedes Wochenende mindestens ein LARP irgendwo in Deutschland stattfindet. Einen Terminkalender mit sehr vielen LARP-Terminen findest Du unter http://www.larpkalender.de
Für den Anfang ist es am besten Du suchst Dir eine günstiges Liverollenspiel heraus, evtl. einen "Zeltcon" mit Selbstverpflegung, d.h. die Übernachtung findet in Zelten statt und um sein Essen muß sich jeder selbst kümmern. Wenn Du ein passendes Liverollenspiel herausgesucht hast, ist es am besten, bei der Kontaktperson für dieses LARP nach einer Anmeldung zu fragen. Falls das LARP noch nicht ausgebucht ist, wird die Spielleitung Dir daraufhin die Anmeldung zuschicken, in der Du dann auch meistens noch weitere Informationen zu dem LARP findest. Viele Anfänger haben Angst, daß sie auf ein Liverollenspiel gehen und dort nur auf erfahrene "alte Hasen" treffen und sich fürchterlich blamieren. Das ist sicherlich nicht der Fall. Auf so ziemlich jedem Liverollenspiel wirst Du auch auf andere Anfänger treffen und die meisten Spielleitungen sind im Vorfeld des LARPs gerne dazu bereit, Dir bei konkreten Fragen und Problemen zu helfen.
Wo finden Live-Rollenspiele statt?
Das ist völlig unterschiedlich. Die kurzen Liverollenspiele, die nur über einen Tag oder Abend gehen, finden oft in einem Waldstück mit einer angemieteten Grillhütte o.ä. statt. Die längeren LARPs finden meistens auf Zeltplätzen oder in Burgen, Jugenddörfern usw. statt.
Wieviele Leute machen bei einem Live-Rollenspiel mit?
Das geht von 10 Spielern für ein kleines Ein-Abend-LARP bis hin zu mehreren 100 Spielern. Ein großer Teil der Wochenend-LARPs wird aber für ca. 50-150 Leute organisiert. In England und Holland findet jedes Jahr ein großes Liverollenspiel mit mehreren Tausend Spielern statt, in dieser Größe gab es (bisher) aber noch kein Liverollenspiel in Deutschland. Liverollenspiele in dieser Größe sind dann auch normalerweise sogenannte SchlachtenCons, d.h. dort stehen sich dann zwei (oder mehr) gegnerische Truppen gegenüber die eine mittelalterliche Schlacht ausspielen.
Was kostet mich das ganze?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Die Kosten für das Hobby "Liverollenspiel" setzen sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Zum einen benötigt man natürlich eine "Gewandung" (das ist das Kostüm), dann meistens noch allerlei andere Ausrüstung und Kleinkram für den Charakter und last but not least evtl. auch noch einiges an sonstiger Ausrüstung (z.B. ein Zelt für ein Liverollenspiel auf einem Zeltplatz usw.). Bei der Gewandung und Ausrüstung hängt es natürlich sehr davon ab, wie viel man ausgeben will, ob man die Sachen selber macht oder kauft usw. Meine erste Gewandung (eine einfache braune Priesterkutte) hat wohl nicht mehr als 30 DM (für den Stoff usw.) gekostet, mittlerweile habe ich aber bestimmt auch schon mehrere 100 DM in die verschiedensten Gewandungen gesteckt (nach oben sind da keine Grenzen gesetzt.. wenn einen erst die LARP-Sucht gepackt hat ;-)
Und letztendlich kommen dann dann noch die Kosten für das eigentlich Liverollenspiel dazu. Diese liegen meist zwischen 0 und 10 EUR für das kleine selbstorganisierte 1-Abend-LARP und ca.70-100 EUR für das Wochenende in einer Burg mit Jugendherberge und Vollverpflegung.
Gibt es ein Mindestalter für die Teilnahme an LARP‘s?
Das ist je nach Veranstalter unterschiedlich. Bei den meisten Veranstaltern liegt das Mindestalter bei 16 oder 18 Jahren, was hauptsächlich mit der Haftung und Versicherung zu tun hat. Minderjährige benötigen Grundsätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Es gibt aber auch Veranstalter, die jüngere Spieler zulassen, sofern sie in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sind.
Welche Vorkenntnisse brauche ich für ein LARP?
Eigentlich keine. Natürlich schadet es nichts, wenn man vielleicht mal "Der Herr der Ringe" oder sonstige Fantasy-Literatur gelesen oder einige Fantasy-Filme gesehen hat, aber im Grunde genommen ist das Einzige was man braucht, ein wenig Phantasie und die Lust, etwas völlig Neues zu erleben.
Kann man irgendwo mal bei einem LARP zuschauen?
Das wird eher weniger gerne gesehen. Bei einem Liverollenspiel wird versucht, eine möglichst schöne Atmosphäre aufzubauen. Die Teilnehmer geben sich Mühe mit den Gewandungen usw., und da stört es verständlicherweise eher, wenn jemand in Turnschuhen mit der Videokamera im Anschlag mitten über den Burghof rennt. Wenn Du Dich für Liverollenspiele interessierst ist es also das Beste, wenn Du Dich einfach mal zu einem anmeldest. Ab und zu gibt es auch kleine 1-Tages LARPs oder Gewandungstreffen, die sich sehr gut eignen, um mal einen kleinen Blick in das Hobby Liverollenspiel zu werfen.
Gibt es spezeille LARPs für Einsteiger?
Einige Veranstalter organisieren auch spezielle Liverollenspiele für Anfänger, aber das ist eher eine Seltenheit. Ca. 99% aller Liverollenspieler haben auf einem "normalen" LARP mit diesem Hobby angefangen, wenn Du also Interesse an diesem Hobby habt, solltest Du Dich einfach zu einem beliebigen Liverollenspiel in Deiner Nähe anmelden. Die meisten Spielleitungen sind gerne dazu bereit, Dir im Vorfeld des LARPS Fragen zu beantworten und Dir bei der Erstellung eines Charakters zu helfen.
Was sind Einladungs-LARPs?
Einladungs-LARPs sind Liverollenspiele, bei denen die Spielleitung nur bestimmte Leute einlädt. Bei den meisten LARPs sind die Einladungen offen, daß heißt, eigentlich jeder, der sich anmeldet und rechtzeitig bezahlt, darf mitmachen (falls nicht die 300 Leute für 200 Plätze angemeldet sind - Jugendherbergseltern bauen nicht extra für LARPer an ;-) ). Aber keine Panik: Einladungs-LARPs sind eher selten, und irgendwann wird jeder LARPer auch mal zu einem Einladungs-LARP eingeladen... Normale LARPs und Einladungs-LARPs verhalten sich ungefähr wie größere Feten und kleine Geburtstagsfeiern: bei den Geburtstagfeiern beschränkt man sich doch eher auf einige wenige Leute, die man sehr gut kennt.
Gibt es ein Regelwerk für Liverollenspiele?
Eigentlich kann man diese Frage nur mit einem klaren "Jein" beantworten. "Ein" LARP Regelwerk gibt es nicht... sondern es gibt fast so viele Regelwerke, wie Veranstalter. Nun ja.. das ist vielleicht ein wenig übertrieben denn es gibt einige Regelwerke, die recht verbreitet sind. Die bekanntesten Regelwerke sind wohl DragonSys, Silbermond und That's Live.
Welches ist das beste LARP-Regelwerk?
Diese Frage kann definitiv nicht beantwortet werden und führt in den einschlägigen Mailinglisten und Newsgroups regelmäßig zu wahren Glaubenskriegen. Wenn man 10 verschiedenen Liverollenspielern diese Frage stellt, wird man wahrscheinlich ebenso viele unterschiedliche Antworten bekommen, und jeder ist fest davon überzeugt, daß er recht hat. Im Endeffekt muß sich jeder diese Frage also für sich selbst beantworten, nach einigen LARPs merkt man schnell, welche Systeme einem gefallen und welche nicht.
Was bedeutet DKWDDK / Real Fantasy / Freies Spiel?
Oft liest man, daß Liverollenspiele nach dem "DKWDDK" Regelwerk , "Kodex" oder "Real Fantasy" gespielt werden. DKWDDK steht dabei für "Du Kannst, Was Du Darstellen Kannst", und damit ist gemeint, daß versucht wird, möglichst frei, d.h. ohne großes Regelwerk zu spielen. Für einige wenige Dinge, z.B. die Kämpfe oder Magie werden trotzdem Regeln benötigt, aber die versucht man so einfach wie möglich zu halten. "Kodex" ist ein ähnlicher Ansatz, bei dem versucht wird, die Regeln durch einen allgemeinen Verhaltens- und Sicherheitskodex zu ersetzen und auch mit "Real Fantasy" ist nichts anderes gemeint. Dieses Spiel fast ohne Regeln ist dadurch möglich, daß es beim Liverollenspiel ja eigentlich darum geht, die eigenen Aktionen real darzustellen, d.h. es wäre sinnlos, z.B. eine Fähigkeit "Schleichen" einzuführen. Wer sich an jemanden heranschleichen will, der soll es eben tun, und wenn er dabei so viel Lärm wie eine Horde Elefanten macht, dann kann ihm auch kein Regelwerk mehr helfen. Den meisten Anfängern ist es natürlich lieber, wenn sie ein Regelwerk haben, an das sie sich halten können, aber auch auf einem LARP mit "freiem Spiel" sollte es kein Problem sein, sich schnell zurechtzufinden.
Wo bekomme ich ein LARP-Regelwerk her?
Einige Regelwerke sind frei im Internet verfügbar. Unter folgenden Adressen findest Du einige Links zu Regelwerken im Internet:
http://www.larp-welt.de/Regeln
Außerdem gibt es unter der Adresse http://www.larpinfo.de/larpi30.htm eine gute Übersicht über einige LARP-Regelwerke mit Bezugsadressen, Preisen usw.
Die meisten Regelwerke, kann man über den Veranstalter des jeweiligen LARPs erhalten, sofern es sich nicht, wie z.B. bei DragonSys, um ein kommerzielles Regelwerk handelt, daß es nur in gedruckter Form über den Buchhandel oder (Live-)Rollenspiel-Läden zu kaufen gibt.
Wer überprüft, ob sich alle an die Regeln halten? Gibt es Schiedsrichter?
Schiedsrichter im herkömmlichen Sinn gibt es bei einem Liverollenspiel nicht. Zwar gibt es die Spielleitung, aber die besteht normalerweise nur aus wenigen Personen, die natürlich nicht jeden Spieler auf Schritt und Tritt überprüfen können. Bei einem Liverollenspiel wird also darauf vertraut, daß die Spieler nicht betrügen und sich an die Regeln halten. Spätestens wenn ein Spieler auch nach dem 100. Treffer immer noch steht, werden die anderen Spieler sich wahrscheinlich bei der Spielleitung beschweren.
Was macht die Spielleitung?
Während des LARPs ist die Spielleitung für viele verschiedene Aufgaben zuständig. Zum einen ist sie es, die die Nicht-Spieler-Charakteren (NSC) dirigiert und damit den kompletten Spielfluß steuert und teilweise auch beeinflußt. Außerdem übernimmt die Spielleitung quasi die Rolle des Schicksals für die Spiele aufwendigeren Zaubersprüchen oder Ritualen entscheidet sie darüber, ob und wie es gewirkt hat usw. Man kann sagen, daß die Spielleitung während des Liverollenspiels alle Fäden in der Hand hält (oder zumindest haben sollte) und das komplette Spiel koordiniert. Erfahrungsgemäß ist das eine recht anspruchsvolle Aufgabe, so daß die Spielleitung am Ende des LARPs oft sowohl körperlich als auch geistig ziemlich am Ende, aber trotzdem glücklich über das vollbrachte Werk ist.
Gibt es so etwas wie Abenteuerpunkte?
Das hängt von dem jeweiligen Regelwerk ab, nach dem man spielt. Bei den meisten Regelwerken werden die Spieler in irgendeiner Form mit Abenteuerpunkten belohnt für die sie sich dann neue Fertigkeiten, Zaubersprüche usw. "kaufen" können.
Gibt es ein Fertigkeitensystem?
Bei vielen LARP Regelwerken gibt es Fertigkeiten, die man sich für seine Abenteuerpunkte erkaufen kann. Im Gegensatz zum herkömmlichen Blatt-Rollenspiel geht es beim LARP aber darum, seine Aktionen real auszuführen. Es würde also keinen Sinn machen, im Liverollenspiel eine Fertigkeit "Schleichen" einzuführen, denn wer sich an den Gegner heranschleichen will, der soll es eben real machen, und wenn er dabei soviel Krach wie eine Horde Elefanten macht, dann hilft ihm da auch irgendeine Fähigkeit "Schleichen" nicht weiter. Fertigkeiten werden deshalb nur bei den Dingen eingesetzt, die man real nicht darstellen kann, z.B. Magie usw.
Wie kann ich meine Fertigkeiten verbessern?
Wie in den vorangegangenen Antworten schon erläutert, sind Fertigkeiten nur für sehr wenige Dinge im Liverollenspiel sinnvoll (wenn überhaupt). Solche Dinge wie "Schwertkampf" kann man halt nur verbessern, in dem man real übt und lernt, mit seiner Polsterwaffe besser umzugehen. Wie genau (und ob überhaupt) man seine Fertigkeiten verbessern kann, ist je nach Regelwerk anders geregelt. Aber zumindest eines ist bei allen Regelwerken gleich. Man sollte versuchen, das erlernen einer neuen Fertigkeit in irgendeiner Form im Liverollenspiel ausspielen. Ein Magier, der einen neuen Spruch lernen will, könnte sich z.B. im Spiel einen anderen Magier suchen, der ihm diesen Spruch beibringt usw.. das macht die ganze Sache sehr viel reizvoller als sich nach dem LARP einfach zuhause mit dem Regelwerk hinzusetzen und sich für die neu errungenen Abenteuerpunkte dort einfach einen neuen Zeuberspruch auszusuchen.
Wird bei einem LARP wie bei einem Pen'n Paper*-Rollenspiel gewürfelt? (*Stift und Papier)
Diese Frage kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Der einzige Grund, bei einem LARP zu würfeln, ist ein nettes Glücksspielchen bei dem man Abends in der Taverne seine letzten Kupferstücke verzockt. Da bei einem Liverollenspiel alles real ausgespielt wird, ist es in keiner Situation notwendig, irgendwelche Aktionen durch Würfeln entscheiden zu müssen.
Kann mein Charakter im LARP sterben? Was dann?
Die meisten Liverollenspiele spielen in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt voller Gefahren und Mythen.. da ist es nicht verwunderlich, daß das Leben eines Helden oftmals nicht durch das Alter sondern durch andere Umstände beendet wird, sei es nun durch eine tödliche Verwundung in einem Kampf oder ein heimtückisches Giftattentat. Wenn ein Charakter stirbt (was aber nicht sooo oft vorkommt), dann gibt es für den Spieler zwei Möglichkeiten. Entweder er spielt nun einen anderen Charakter oder aber (falls er Lust dazu hat.. und nur dann!) übernimmt er für den Rest des LARPs eine NSC-Rolle (Nicht-Spieler-Charakter). Auf jeden Fall sollte man der Spielleitung bescheidgeben, wenn der Charakter den Weg alles vergänglichen gegangen ist.
Was benötige ich an Ausrüstung?
Für meinen Charakter
Je nach Charaktertyp und -klasse braucht man passende Ausrüstung. Das fängt bei der Gewandung an : für einen Krieger sollte mindestens eine einfache Lederrüstung zur Verfügung stehen, ein Magier kleidet sich meist in Roben oder lange Umhänge. Grundausstattung für jeden Charakter sollte ein entsprechendes Hemd (Rüschen/Steckhemd), Hose (hier tuts auch eine schwarze unauffällige Hose) und ein warmer Umhang sein (Und wenn der wasserdicht ist umso besser). Hilfreich ist eine Polsterwaffe, die an den Charakter angepaßt ist (Stab für Magier, Schwert für Krieger) . Letzten Endes sollte aber eines klar sein: Das eigene Spiel entsscheidet, und nicht wie teuer/aufwendig die Ausrüstung ist. Des weiteren ist der "Kram" recht wichtig: Feder, Tusche, passendes Papier (Elefantenhaut), Gürteltaschen aus Leder (je mehr umso besser), Trinkbeutel, Schmuck, sowie Besteck eine Holzschüssel und ein Messer (nicht zu groß, das ist schließlich kein Survival-Camp).
Für mich selbst
Wer auf einen Zeltcon fahren will, sollte jemanden kennen, der ein Zelt besitzt, das sich für LARPs eignet oder beim Veranstalter anfragen, ob Zelte gestellt werden (gar nicht so selten). Eher ungern werden Igluzelte in quitschbunten Farben gesehen, es sei denn, man hat Material dabei, dieses entsprechend zu tarnen. Und ein normales (Bundeswehr) Tarnnetz verdeckt in den wenigsten Fällen die Silberbeschichtung. Zur Gewandung gehören warme Sachen zum Drunterziehen! Meist sind die Nächte recht kalt. Alles was man nicht unter der Gewandung trägt, sollte ambientegerecht sein: (Wasserschlauch/Tonflasche statt der Plastiktrinkflasche, Lederbeutelchen am Gürtel statt Geldbörse, Feder&Tusche statt Kugelschreiber), Stiefel statt Turnschuhe. Grob kann man sagen: alles was auf einem Con andere Spieler sehen sollte nach Möglichkeit nicht zu modern aussehen. Des weiteren evtl. einen Schlafsack (toll sind da natürlich Decken und Felle) bzw. Bettwäsche falls der Con in einer Jugendherberge stattfindet, Wasch- & Hygenesachen, Krankenversicherungskarte und im Falle eines Zeltcons, was man sonst so mit zum Camping nimmt. Es ist auch nie verkehrt Klopapier mitzunehmen (allgemeine Conerfahrung: Klopapier ist irgendwann alle ;-)
Auch nicht zu unterschätzen: ist der Con ein selbstversorger Con, d.h. man muß sich sein Essen dort selber machen, dann ist an Kochmöglichkeit (Rost, Dreibein, Zur Not auch Gaskocher..) Kochgeschirr und natürlich passendes Rohmaterial zu denken (Pizza ist schwierig zu grillen und Fleisch über mehrere Tage in der Sonne zu lagern ist auch nicht so gesund).
Aber auch zu einem Vollverpflegungscon empfiehlt es sich, ein wenig Geld mitzunehmen. Einerseits, weil man vielleicht von einem Händler noch Polsterwaffen oder andere Ausrüstung kaufen will, andererseits, weil Getränke sehr oft nicht in der Vollverpflegung inbegriffen sind.
Wie ist das mit solchen Sachen wie Brillen, Armbanduhren, Zigaretten usw.?
Da Sicherheit im Liverollenspiel auf jeden Fall an erster Stelle steht, ist gegen eine Brille natürlich nichts einzuwenden. Klar, Kontaktlinsen sind schöner, aber es ist absolut kein Problem seine Brille im LARP auf zu behalten, schließlich spielen die meisten LARPs ja in einer Fantasywelt und da kann man die auch mit "das ist ein seltsames Gnomenprodukt" o.ä. erklären. Bei Armbanduhren ist das etwas anderes.. die sind nicht für die Sicherheit notwendig, sollten also genau wie die neongelben Turnschuhe zuhause bleiben. Zigaretten (Rauchkraut genannt ;)) passen zwar auch nicht unbedingt in das Ambiente, aber da wäre wohl jeglicher Versuch, sie zu verbieten, vollkommen zwecklos. Eine schöne Pfeife ist natürlich für das Ambiente schöner, wenn es denn die Zigaretten sein müssen, dann achtet bitte wenigstens darauf, die Zigarettenstummel nicht in den Wald zu werfen und legt die Marlboro-Schachtel nicht unbedingt in der Taverne auf den Tisch.
Muß meine Gewandung und restliche Ausrüstung authentisch Mittelalterlich sein?
Das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Gehen wir mal von einem Fantasy LARP aus (bei Cyberpunk, Vampire usw. gelten sowieso ganz andere Voraussetzungen). Das schöne am Fantasy ist, daß es eben eine Welt unserer Fantasie und keine Abbildung des realen Mittelalters (sogenanntes Re-Enactment) ist. Auf dem LARP laufen Elfen, Orks und andere seltsame Wesen herum und stämmige Nordmänner sitzen mit turbanbedeckten Wüstensöhnen am Tisch. Man sollte halt darauf Achten, daß die Gewandung nicht zu modern aussieht (Turnschuhe und Neongelbes Hemd sind tabu), aber ansonsten ist fast alles erlaubt. Man nehme sich einfach einen x-beliebigen Fantasy-Film als Vorlage.
Wo bekomme ich die Ausrüstung her?
"Googled" einfach im Internet etwas herum mit Suchbegriffen wie "Gewandungen, Mittelalter" oder "LARP, Zubehör". Es gibt hunderte Händler die bereits im I-Net vertreten sind, und sämtliches Bedarf mehr oder weniger günstig anbieten. Des weiteren bieten kleine LARP Händler in größeren Städten vorort Ihre Waren an. Kleiner Tip: PREISE VERGLEICHEN ! ;)
Wo bekomme ich Gewandungen her?
Auch hier lohnt sich ein Blick ins Internet. Das beste ist natürlich: selber nähen (Schnitte s.u.). Hin und wieder findet man geeignete Sachen auf Flohmärkten, Second Hand Shops und in Ausstattern der Gruftiszene. Komplette Gewandungen gibts bei Händlern, das kostet aber oft sehr viel. Wer schon andere Spieler kennt, kann die durchaus fragen. Bei Liverollenspielern sammelt sich mit der Zeit einiges an Gewandung an. Selten stellt auch der nette Veranstalter das eine oder andere Stück für Anfänger zur Verfügung. Der ortsansässige Kostümverleih ist auch noch eine Alternative, allerdings eine teure und meist eher unpassende (da eher weniger Fantasytauglich).
Wo bekomme ich Polsterwaffen her?
Entweder vom Händler oder selberbauen. Selberbauen ist billiger sieht aber oft nicht so schön aus. Oft kann man sich auch vor Ort von eine anderen Larper was leihen oder den Veranstalter fragen. Oder...RICHTIG, ins Internet schauen ! :)
Wo bekomme ich Rüstungen her?
Auch hier kann ein Larphändler weiterhelfen, aber im allgemeinen ist hier viel mehr Eigenbau angesagt. Ringe für Kettenhemden gibts incl. Bastelanleitung bei ebenjenen Händlern (wer sich das wirklich antun will. Denn ein Kettenhemd ist was für laaange Winterabende), für Schuppen- und Plattenrüstungen gibt's Blech (nehmt bitte nur Metall. "Strickkettenhemden" sind ungern gesehen.) im Baumarkt oder am Schrottplatz (ja ehrlich) , Leder ist am billigsten auf Wochenmärkten zu bekommen (muß man aber etwas Geduld haben). Und wie bei den anderen Dingen auch gilt: fragt doch einen Larper den ihr schon kennt, versucht euch was zu borgen, und spielt einen Charakter den ihr auch darstellen könnt. Weniger ist oft mehr. Wer etwas mehr Geld anlegen will, findet auch oft auf *manchen* Mittelaltermärkten Händler (insbesondere aus Ost-Europa) die Rüstungsteile verkaufen und bei denen man sich für das nötige Kleingeld auch eine komplette Plattenrüstung maßschneidern lassen kann.
Ich möchte mir selbst eine Polster-Waffe bauen. Wie geht das?
Es werden folgende Materialien benötigt:
Kernstab (GFK o.ä. )
Isomatte
Pattex
Tapezieremesser
Latex incl Abtönfarbe oder Tape.
Leder
Zuerst den Stab auf eine passende Länge absägen (dabei bedenken daß bei der Spitze etwa 5 cm Platz sein soll.), Spitze mit Leder umwickeln dann Isomatte anbringen. 3 Lagen sind eine minimaldicke und um den Stab sollte immer etwa 2 cm Polstermaterial sein. Dann die Isomatte in die gewünschte Form Schneiden, und mit Latex bepinseln (8 Schichten minimum) oder umtapen. Für eine Kampfstab kann man aber auch Rohrisolierung verwenden (dabei achten daß die Naht nicht zu hart wird). Anschließend immer die Waffe gründlich durchtesten. Solltest du das erste mal auf einem Larp sein bitte doch die Spielleitung deine Waffe genau zu prüfen. Auch wird dir jeder erfahrene Waffenbauer gern Tips geben.
Wie pflege ich meine Polsterwaffe?
Gelatexte Polsterwaffen niemals lange in der prallen Sonne rumliegen lassen, also z.B. nicht im Auto auf der Hutablage. Der Latex löst sich sonst ab ("Latexkrebs").
Schwerter niemals auf die Spitze stellen, durch das Knicken können Bruchstellen im Schaumstoff entstehen, die man unter dem Latex nicht sieht.
Unbeschichtete Waffen, die also nur eine Latexhülle haben und nicht nocheinmal mit einer Schutzschicht lakiert sind, immer gut mit Talkum pudern und gelegentlich abwaschen, durchaus auch mit Seife. Fett, z.B. von den Händen, kann sonst auf Dauer die Latexoberfläche zerstören.
Wenn sich das Latex auflöst oder Blasen wirft (Latexkrebs, Latexpest), sollte die Waffe nicht mehr verwenden. Dieser Zersetzungsprozeß des Latex hat die unangenehme Eigenschaft auch auf andere Waffen überzuspringen, die damit in Berührung kommen (ist irgendein chemischer Prozess). Evtl. kann man die Waffe noch retten indem man die komplette Latexhaut abzieht und die Waffe komplett neu latext. Keinesfalls einfach über die zersetzten Stellen neu drüber latexen!
Ich möchte mir selbst eine Gewandung nähen, wo bekomme ich Anleitungen?
Hier gibt es verschiedene Quellen. Die wichtigste und beste ist die eigene Phantasie und Übung. In Stoffabteilungen von Kaufhäusern lassen sich auch Schnittmuster finden, die meist, wenn es keine Karnevalsschnitte sind, nur noch abgewandelt werden brauchen (für Roben eignet sich z.B. der Bademantelschnitt). Den Schnitt eines T-Shirts ohne Armansätze kann man für ein Lederwams benutzen. Wer Glück hat, hat eine Mama oder Oma, die noch richtig nähen können und meist recht bereitwillig helfen.
Mit welchen Waffen wird bei einem LARP gekaempft?
Allgemein wird auf einem LARP (zumindest im Fantasy-Bereich) nur mit sogenannten Polsterwaffen gekämpft. Das sind Waffen aus Schaumstoff, mit einem Glasfaser-Kern, die mit Latex oder Tape überzogen sind. Auch Bolzen/Pfeile werden mit einer Schaumstoffspitze geschützt. Genaueres zu Bau oder Beschaffung von solchen Waffen findet ihr in Kapitel 5 dieser FAQ. Echte Waffen, und alle Waffen die ein Verletzungsrisiko bedeuten würden sind natürlich nicht auf einem LARP erlaubt.
Wie ist das mit den Rüstungen auf einem LARP?
Kurz gesagt: Allgemein zählen nur "echte" Rüstungen. Kettenhemden müssen aus Metall sein, Lederpanzer aus Leder. Attrappen, wie Papp-Plattenpanzer, Woll-Kettenhemden werden im allgemeinen nicht akzeptiert, aber auch leichte Aluminium-Rüstungen oder ähnliches sind oft nicht gerne gesehen. Aber keine Angst, man kommt auf durchaus ohne meist teure "echten" Rüstungen aus auf einem LARP.
Nach welchen Regeln wird auf einem LARP gekämpft?
Dies ist von Con zu Con (und dem dort verwendeten Regelsystem) unterschiedlich. In Punktebasierenden Systemen machen Waffen oft Schadenspunkte, die der getroffene Spieler/NSC von seinen Lebens/Rüstpunkten abziehen muß. Auf DKWDK-Cons werden Waffentreffer eben von den Mitspielern nach ihrem Verständnis ausgespielt. Hier ist die eigene Fairneß gefragt, Treffer zu akzeptieren und auszuspielen.
Welche Sicherheitsregeln gibt es im Kampf?
Kampfaktionen die ein Verletzungsrisiko für den Gegner bedeuten würden sind nicht erlaubt. Insbesondere ist hier zu erwähnen dass Schläge/Schüsse gegen den Kopf des Gegners sind nicht erlaubt. Auch waffenloser Kampf (Kampfsport-Techniken, Faustschläge, usw.) sind nicht erlaubt. Ebenso nicht erlaubt ist der sogenannte "In- Fight", also der extreme Nahkampf, den Gegner anspringen, niederrennen oder ähnliches. Allgemein ist Vorsicht und auch Rücksichtnahme auf den Gegner im Kampf sehr wichtig. Auf allen Larps gibt es den Stop Befehl. Bei einer ernsthaften Gefahr wird laut Stop gebrüllt, und alle beenden sofort das Spiel bis die Gefahrensituation unter Kontrolle ist. Ein versehentlicher Hieb in die Weichteile kann einen den ganzen Abend versauen ;)
Generell sollten auch Schläge mit einer Polsterwaffe immer abgebremst werden, bevor man den Gegner trifft. Eine voll durchgezogene Polsterwaffe kann durchaus schmerzhaft sein. Allerdings muß man auch damit rechnen, daß man im Eifer des Gefechts mal einen blauen Fleck bekommt, auch wenn so harte SChläge eigentlich vermieden werden sollten. Desweiteren ist das "Stechen" nicht gestattet, da trotz Latex-Ummantelung ein starrer Stab in der Waffe steckt, der zu ernathaften Verletzungen führen kann.
MUß ich auf einem LARP kämpfen?
Nein, selbstverständlich nicht. Auch Wegrennen ist oft eine sehr sinnvolle Alternative. Die meisten SL achten auch darauf, daß es für weniger kampflustige Spieler die Möglichkeit gibt Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Die meist sehr enthusiastische Kriegerschar wird auch bestimmt dafür sorgen, daß euer taktischer Rückzug nicht besonders auffällt. Also keine Sorge, wer nicht kämpfen will wird auch bestimmt auf keinem LARP dazu gezwungen sein.
Wie funktioniert Magie auf einem LARP?
Magie ist eine der wenigen Dinge im Liverollenspiel, die nicht real ausgespielt werden können und deshalb simuliert werden müssen. Dazu ist ein wenig Phantasie von allen beteiligten Notwendig. In den meisten Regelwerken ist es so, daß jeder Magier eine bestimmte Anzahl von Zaubersprüchen beherrscht. Es ist nun Aufgabe des Magiers, seinem Opfer irgendwie klar zu machen, was mit diesem geschieht. Normalerweise benutzt der Magier für einen Zauberspruch irgendwelche Komponenten, Gesten und Worte aus denen dann klar wird, welchen Spruch er spricht. Wenn ich mich als Magier vor mein Opfer stelle, irgendwelche seltsamen Gesten mache, ihm dann die Hand auf die Stirn lege und den Spruch "Ruhe Deinem Geiste, Friede Deiner Seele - Schlafe ein!" sage, wird dieser schon wissen, was er tun soll, nämlich in einen tiefen Schlaf fallen. Es gibt auch eine ganze Reihe "Standardsprüche", deren Auswirkung jeder Liverollenspieler kennen sollte, z.B. sollte auch ein Krieger wissen, daß er bei einem "Windstoß" einige Meter zurückgeworfen wird usw.
Mit welchen Hilfsmitteln wird Magie im Liverollenspiel dargestellt?
Für viele Sprüche sind irgendwelche Komponenten notwendig. Z.B. wird ein Feuerball meistens durch einen roten Softball dargestellt, den der Magier auf sein Opfer wirft usw. Bei einigen Regelwerken sind die Sprüche und Komponenten fest vorgeschrieben, andere lassen dem Zaubernden da die freie Wahl. In manchen alten Regelwerken wird vorgeschrieben, daß der Zaubernde bei einem Spruch Mehl auf den Gegner wirft.. das sollte tunlichst unterlassen werden, da Mehl in den Augen zu sehr schlimmen Entzündungen führen kann. In neueren Regelwerken sollte Mehl als Wurfkomponente deshalb nicht mehr zu finden sein.
Was brauche ich an Ausrüstung für einen Magier?
Es ist sehr schwer, da eine allgemeingültige Antwort zu geben. Es kommt halt darauf an, wie weit man den Begriff "Magier" ziehen will. Ein klassischer "arkaner" Magier im Stil von Merlin oder Gandalf benötigt sicherlich eine andere Ausrüstung als ein Schamane oder eine Hexe. Ich gehe hier deshalb mal vom klassichen arkanen Magier aus. Fuer diesen ist wohl sein Zauberbuch das wichtigste Utensil. Dort sind alle seine Zaubersprüche, Ihre Anwendung un Wirkung aufgeschrieben. Als Gewandung bevorzugen viele Magier eine lange Robe, evtl. mit einer weiten Kaputze und als Waffe z.B. einen Kampfstab. Aber das sind natürlich nur Vorschläge. Magier sollten es aber vermeiden, sich in schwere Rüstungen zu quetschen oder mit großen Schwertern herumzulaufen... das sollte man dann doch lieber den Kriegern überlassen, zumal es in vielen Regelsystemen auch gar nicht erlaubt ist, als Magier Metallrüstungen oder schwere Waffen zu tragen. Weitere beliebte Utensilien für Magier sind Mehl (nur, um Bannkreise auf dem Boden zu ziehen - nicht zum werfen!), Kerzen, Rauchtabletten und sonstige Pyrotechnik (muß unbedingt vorher von der Spielleitung abgesegnet werden!). Der eigenen Phantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt.
Welche Religionen gibt es im LARP?
Eigentlich alle Religionen die eine Fantasywelt zu bieten hat. es gibt unendlich viele Götter und dazugehörige Kulte, mehr oder weniger gut ausgearbeitet. Reale Religionen gibt es nicht. Auch sollte man wissen daß niemand der einen Larp Priester spielt real an seine (gespielte) Religion glaubt.
Kann ich mir eine neue Religion ausdenken?
Klar. Fühl dich frei und ungezwungen. Wichtig ist folgendes: Benutz keine Götternamen die es in unserer realen Welt gibt, benutz keine Symbole, Praktiken, Texte und Kostüme einer real existenten Religion. Nun sollte es noch einen guten Hintergrund, Grundsätze und Gebote etc. geben. Solltest du eine Religion erfinden/übernehmen so ist auf eine Verbindung zur Hintergrundkultur zu achten. Kleiner Hinweis am Rande: guck doch zuerst mal obÝs nicht schon eine entsprechende Larp Religion gibt.
Eine gute Quelle ist das Kapitel "Gottheiten und Kulte" der Larpinfo:
http://www.larpinfo.de/larpi37.htm
Kann ich einen Priester einer realen Religion spielen?
Nein. Davon sei hier ausdrücklich abgeraten. Die damit verbundenen Konflikte für dich und deine Mitspieler sind grösser als du denkst. Laß auch Wicca, Satanismus und sonstige Kulte aus dem Spiel. Da gehören sie nämlich nicht hin.
Was brauche ich an Ausrüstung für einen Priester?
Das hängt stark von der bespielten Religion ab, eben das was die bespielte Religion verlangt. Im allgemeinen tuts eine einfache Kutte und ein Wanderstab. Viel wichtiger ist bei einem Priester das Spiel und der gut ausgearbeitete Hintergrund
Was ist eine Hofhaltung?
Eine Hofhaltung ist ein LARP in höfischem Ambiente. Meistens Burgen oder Schlössern statt und anstatt irgendwelche Abenteurer spielen die Spieler Adelige und den dazugehörigen Hofstaat. Auf Hofhaltungen wird meistens weniger gekämpft, dafür gibt es z.B. viel Diplomatie und Intriegenspiel und oft z.B. auch einen Ball mit mittelalterlichen Tänzen und ein Festbankett.
Kann ich einfach so einen Adeligen spielen?
Bei einigen Regelwerken ist es so, daß man sich einen Adelstitel erst mit Punkten erkaufen muß, bei anderen kann man auch gleich von Anfang an einen Adeligen spielen. Mittlerweile ist es eher üblich, daß man sich einen Adelstitel nicht erst mit Punkten erkaufen muß, das kommt aber immer auf den Veranstalter an. Wenn man einen Adeligen spielen will, sollte man das am besten in einem schon bestehenden LARP-Land machen, dann muß das aber unbedingt mit dem Verwalter dieses Landes bzw. mit dem Verein dem dieses Land "gehört" abgesprochen werden. Wenn Ihr einen Adeligen spielen wollt, solltet Ihr z.B. auch daran denken, daß Ihr z.B. Personal (d.h. Hofstaat) und auch eine entsprechende Gewandung haben solltet. Ein König von BlahBlub der mit einer Jeans und einer eilig zusammengeschusterten Gewandung alleine auf einem Con erscheint wird wahrscheinlich von den restlichen Spielern nicht die Beachtung finden, die er sich erhofft.
Was wird im LARP als "Kampagne" bezeichnet?
Im Gegensatz zur Kampagne im Papierrollenspiel oder bei TableTops wird beim Hintergrund als solche bezeichnet. Im Ursprünglichen Sinn ist eine Kampagne ein "Feldzug", also eine Folge von Schlachten mit einem bestimmten Ziel (meistens die anderen zu besiegen), im Rollenspiel sind damit meistens mehrere verknüpfte Abenteuer gemeint. Beispielsweise müssen die Helden erst ein paar Artefakte besorgen um dann gegen den bösen Magier anzutreten. Sowas ist auch im LARP möglich und nicht selten. Da die Charaktere aber öfter von Abenteuer zu Abenteuer (also von Con zu Con) wechseln sind die einzelnen Cons meist eher lose verknüpft, aber es gibt auch Ausnahmen.
Im LARP wird, wie erwähnt, auch häufiger eine Verknüpfung mehrerer Länder als Kampagne bezeichnet. Hier sind insbesondere zwei Kampagnen im deutschen Sprachraum bekannt, die Mittellande und die Ostlande.
Was ist die Mittelland Kampagne?
Die Mittellande entstanden offiziell im Jahre 1995. Hier haben sich einige Veranstalter zusammengefunden um ihre Lände auf einer gemeinsamen Karte zu verzeichnen um Diplomatie, Handel und Kriege besser ausspielen zu können. Mittlerweile gibt es etwa 80 Länder in den Mittellanden. Es gibt neben der Website (http://www.mittellande.de), auch eine Broschüre: "Die Länder der Mittellande", mit Kurzvorstellungen der meisten Länder. Wer seinen Charakter aus einem Land der Mittellande kommen lassen will, sollte mit dem entsprechenden Veranstalter Kontakt aufnehmen um sich detailierte Hintergrundinformationen zu besorgen.
Was sind die Ostlande?
Die Ostlandkampagne ist eine kleine Kampagne, die im Sommer 1999 gegründet wurde.
Gibt es auch noch andere Kampagnen?
Es gibt noch einige andere kleinere Kampagnen, die von mehreren Orgas bespielt werden. Die meisten Kampagnen werden aber von einzelnen Orgas speziell für ihr Land gespielt. Auch gibt es bei den vielen Ländern, die in keiner der beiden Gemeinschaftskampagnen angeschlossen sind, mitunter Verknüpfungen mit anderen Ländern.
Hat LARP etwas mit Okkultismus und Sekten zu tun?
Besonders in den Anfangstagen des LARPs gab es öfters mal solche Vorwürfe. Das ist irgendwo auch zu verstehen, zumindest aus der Sicht von irgendwelchen uninformierten Aussenstehenden, die davon hören, daß sich da Menschen in seltsamen Klamotten auf Burgruinen versammeln und irgendwelche magischen Rituale veranstalteten. Manche Menschen konnten sich unter dem Hobby LARP einfach nichts Konkretes vorstellen und haben es dann leichtfertig in die Schublade Sekten/Okkultismus verbannt. Ein Übriges haben die Medien erledigt. Für die Boulevardpresse ist es natürlich viel interessanter über eine Gruppe Verückter zu berichten, die nachts im Wald irgendwelche okkulten Dämonenbeschwörungen machen anstatt über kreative Menschen mit einem spannenden und kommunikativen Hobby. Mittlerweile ist das Hobby LARP, nicht zuletzt durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, aber schon längst von diesem Image abgekommen und die Presseberichte der letzten Zeit waren eigentlich überwiegend positiv. Selbst Kirchen und Kommunen haben Liverollenspiele mittlerweile für sich entdeckt und arbeiten oft eng mit den Veranstaltern zusammen. Ich war sogar schon auf einem LARP, das von einem katholischen Priester veranstaltet wurde, der das Hobby für sich entdeckt hat.
Gibt es LARP-Vereine? Wenn ja, wo?
In fast jeder größeren Stadt Deutschlands gibt es mittlerweile einen LARP-Verein oder eine LARP-Gruppe. Eine Liste mit einigen LARP-Vereinen gibt es auf der Larpinfo unter http://www.larpinfo.de
Wie kann ich selbst ein LARP veranstalten?
Das ist ein kompliziertes Thema, das hier nicht mit einigen Sätzen abgehandelt werden kann. Generell kann man sagen, daß man erst einmal ein wenig Erfahrung als Spieler oder NSC sammeln sollte, bevor man selbst an die Organisation eines LARPs geht. Ein weiterer guter Rat ist es, ein LARP mit der Unterstützung einer Person oder eines Vereines zu organisieren, die darin schon Erfahrung hat. Im Moment schreibt Marcel Jost (mjost@drachenreiter.de) gerade mit der Unterstützung von Thilo Wagner an einem "Orga-Handbuch", das hoffentlich bald kostenlos im Web zu finden sein wird und einige Tipps und Hinweise zur Organisation eines eigenen LARPs enthält.
In welchen Genres gibt es LARPs? Gibt es z.B. auch Cyberpunk-LARPs?
Der größte Teil der Liverollenspiele in Deutschland spielt im Fantasy- oder manchmal auch im Mittelalter-Bereich. Daneben gibt es noch eine ganze Menge LARPs nach dem Vampire-System von White Wolf, eigentlich ein Pen&Paper System daß aber auch für das LARP adaptiert wurde und besonders in Amerika mangels fantasytauglicher Locations sehr populär ist. Aber es gibt ab und zu auch LARPs in anderen Genres, z.B. Cyberpunk, Science Fiction, Horror, Krimie (wer ist der Mörder?), Western usw. Denkbar ist eigentlich alles.
Gibt es Literatur/Fanzines/Online-Magazine zum Thema LARP?
Sicher...einfach mal "googlen" :)
Es gibt mehrere eine ganze Reiche Publikationen zum Thema LARP.
Zum einen gibt es mehrere private Online-Magazine in denen mehr oder weniger regelmäßig neue Artikel und Texte zum Thema LARP veröffentlicht werden. Als Auswahl sollten mal die beiden folgenden reichen:
Das Online-Magazin von LARP-Welt:
http://larp-welt.de/newmag.shtml
Der Almanach:
http://www.almanach-online.de/
Eine Liste von privaten Fanzines und Online-Magazinen zum Thema LARP gibt es auf:
http://www.larpinfo.de/story/intro.htm
Daneben gibt es noch eine ganze Reiche gedruckter Literatur zum Thema LARP, auch da gibt es in der Larpinfo eine gute Liste auf die ich verweisen möchte:
http://www.larpinfo.de/story/intro.htm
Last but not Leat die Regelwerke. Auch hier verweise ich lieber auf Larpinfo und LARP-Welt da beide recht umfangreiche Listen mit Links zu Regelwerken im Internet haben:
http://larp-welt.de/Regeln/
http://www.larpinfo.de/larpi30.htm
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema Liverollenspiel?
Mittlerweile gibt es hunderte von LARP-Seiten im Internet, deswegen werde ich hier nur auf drei auserwählte Seiten Linken die sich entweder gut als Startpunkt für eine Reise durch die LARP-Seiten im Web eignen oder nützliche Informationen speziell für Anfänger bieten.
Marcus Ertls LARP-Welt ist eine Web-Katalog im Stil von Yahoo, speziell für deutsche LARP-Seiten. Falls Ihr also eine LARP-Seite zu einem bestimmten Thema sucht, seid ihr dort genau richtig:
http://www.larp-welt.de
Unmengen nützlicher Informationen rund um das Thema Liverollenspiel findet man außerdem noch in Jens Tiefenstädters Larpinfo, zu finden unter
http://www.larpinfo.de
Wenn Ihr Termine von Liverollenspielen sucht, dann werft mal einen Blick in Thilo Wagners LARP-Kalender, zu finden unter:
http://www.larpkalender.de
Bilder von vergangenen Liverollenspielen findet man unter:
http://www.larp-bilder.de
Berichte über vergangene Liverollenspiele findet man unter:
http://www.crosswinds.net/~tinod/java.htm
Weitere Fragen können auch in der LARP-Mailingliste gestellt werden. Mehr Informationen zu der LARP-Mailingliste gibt es auf:
http://www.mordor.ch/drosrock/ml/
Last but not least gibt es auch eine LARP-Newsgroup, in der allerdings weit weniger los ist als in der LARP-Mailingliste:
de.rec.spiele.rpg.live
TEXTQUELLE: http://www.cl.uni-heidelberg.de/~kmayer/qa_larp.htm
Was bedeuten die Wochentage ?
<--- Lest auch CELTIC WORLD !
(Ergänzungen werden gerne entgegegenommen !)
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!
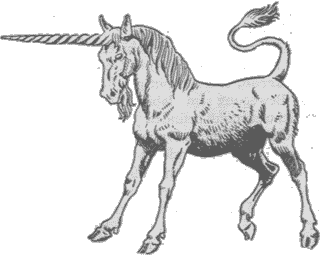 Ein Einhorn ist ein wunderschönes, dem Pferd ähnliches Geschöpf von großer Schnelligkeit. Das Einhorn ist das Sinnbild für Reinheit und ungebändigte Kraft. Sein besonderes Kennzeichen ist ein langes, gedrehtes Horn, das aus der Mitte der Stirn herauswächst und ihm als Waffe dient. Da es jedoch ein sehr sanftmütiges und gutes Wesen besitzt, setzt es diese Waffe nur gegen Geschöpfe des Bösen ein. Einhörner sind sehr scheu, aus diesem Grund verbergen sie sich vor dem Menschen. Da aber insbesondere das Horn des Einhorns große Zauberkraft birgt, z. B. die Heilung von Krankheiten, ist es eine beliebte Jagdbeute und Trophäe für jeden Jäger. Eine herkömmlich Jagd ist nicht möglich, deshalb bedient man sich des Jungfrauentricks: Man hatte herausgefunden, daß Einhörner eine starke Zuneigung zu Jungfrauen empfinden. Deshalb setzt man bei der Einhornjagd eine Jungfrau als Köder ein, um das Einhorn anzulocken. Die Liebe des Einhorns zu der Jungfrau scheint derart groß zu sein, daß sich das Einhorn widerstandslos fangen und seines Horn berauben läßt.
Ein Einhorn ist ein wunderschönes, dem Pferd ähnliches Geschöpf von großer Schnelligkeit. Das Einhorn ist das Sinnbild für Reinheit und ungebändigte Kraft. Sein besonderes Kennzeichen ist ein langes, gedrehtes Horn, das aus der Mitte der Stirn herauswächst und ihm als Waffe dient. Da es jedoch ein sehr sanftmütiges und gutes Wesen besitzt, setzt es diese Waffe nur gegen Geschöpfe des Bösen ein. Einhörner sind sehr scheu, aus diesem Grund verbergen sie sich vor dem Menschen. Da aber insbesondere das Horn des Einhorns große Zauberkraft birgt, z. B. die Heilung von Krankheiten, ist es eine beliebte Jagdbeute und Trophäe für jeden Jäger. Eine herkömmlich Jagd ist nicht möglich, deshalb bedient man sich des Jungfrauentricks: Man hatte herausgefunden, daß Einhörner eine starke Zuneigung zu Jungfrauen empfinden. Deshalb setzt man bei der Einhornjagd eine Jungfrau als Köder ein, um das Einhorn anzulocken. Die Liebe des Einhorns zu der Jungfrau scheint derart groß zu sein, daß sich das Einhorn widerstandslos fangen und seines Horn berauben läßt.
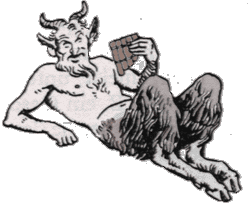 Faune sind gute Feldgeister, die den Fortschritt des Getreidewachstums auf den Äckern der Menschen bewachen. Ihre Gestalt wird als die eines jungen Mannes mit den Hörnern und Füßen eines Ziegenbocks beschrieben. Faune sind bei den Bauern gern gesehene Gäste auf ihren Feldern, da sie sanfte und gutmütige Wesen sind, die meisterlich auf ihrer Flöte spielen und dadurch das Wachstum des Getreides günstig beeinflussen. Ein Bauer sollte jedoch bei der Ernte sehr vorsichtig sein, da er einen unaufmerksamen Faun mit seinem Arbeitsgerät leicht verletzen kann. Faune sind zwar keine nachtragenden Geschöpfe, aber aus Furcht würden alle Faune seinem Feld fernbleiben und sein Getreide wäre ohne die Fürsorge eines Fauns niemals wieder von so guter Qualität wie zuvor.
Faune sind gute Feldgeister, die den Fortschritt des Getreidewachstums auf den Äckern der Menschen bewachen. Ihre Gestalt wird als die eines jungen Mannes mit den Hörnern und Füßen eines Ziegenbocks beschrieben. Faune sind bei den Bauern gern gesehene Gäste auf ihren Feldern, da sie sanfte und gutmütige Wesen sind, die meisterlich auf ihrer Flöte spielen und dadurch das Wachstum des Getreides günstig beeinflussen. Ein Bauer sollte jedoch bei der Ernte sehr vorsichtig sein, da er einen unaufmerksamen Faun mit seinem Arbeitsgerät leicht verletzen kann. Faune sind zwar keine nachtragenden Geschöpfe, aber aus Furcht würden alle Faune seinem Feld fernbleiben und sein Getreide wäre ohne die Fürsorge eines Fauns niemals wieder von so guter Qualität wie zuvor.
 Einer jüdischen Legende zufolge ist der sogenannte Golem ein Wesen aus Wasser und Lehm, das von einem Rabbi mit den eigenen Händen geformt wurde. Mittels eines magischen Wortes, erweckte er die leblose Lehmfigur zum Leben. Da der Golem keine Schmerzen verspürt ist er nahezu unbesiegbar, nur wenige Eingeweihte wissen wie man ihn aufhalten kann. Der Rabbi erschuf ihn zum Schutz der Juden gegen den Feind, zudem erwies sich der Golem auch als dienstbereiter Hausdiener, der klaglos alle ihm aufgetragenen Arbeiten ausführte. Als das Monster aus Lehm jedoch eines Tages außer Kontrolle geriet, hatte der Rabbi seine liebe Mühe ihn wieder einzufangen. Der Golem tobte durch die Straßen und war kaum zu bändigen. Schließlich gelang es mit vereinten Kräften den Golem unschädlich zu machen und in die Keller unter der Synagoge am Ort zu schaffen. Dort soll er sich noch heute befinden und auf seine Wiederbelebung warten.
Einer jüdischen Legende zufolge ist der sogenannte Golem ein Wesen aus Wasser und Lehm, das von einem Rabbi mit den eigenen Händen geformt wurde. Mittels eines magischen Wortes, erweckte er die leblose Lehmfigur zum Leben. Da der Golem keine Schmerzen verspürt ist er nahezu unbesiegbar, nur wenige Eingeweihte wissen wie man ihn aufhalten kann. Der Rabbi erschuf ihn zum Schutz der Juden gegen den Feind, zudem erwies sich der Golem auch als dienstbereiter Hausdiener, der klaglos alle ihm aufgetragenen Arbeiten ausführte. Als das Monster aus Lehm jedoch eines Tages außer Kontrolle geriet, hatte der Rabbi seine liebe Mühe ihn wieder einzufangen. Der Golem tobte durch die Straßen und war kaum zu bändigen. Schließlich gelang es mit vereinten Kräften den Golem unschädlich zu machen und in die Keller unter der Synagoge am Ort zu schaffen. Dort soll er sich noch heute befinden und auf seine Wiederbelebung warten.
 Greife sind Mischwesen aus Löwen und Adlern. Sie haben den Leib eines Löwen und den Oberkörper eines Adlers, samt Schwingen und Federn. Der Greif versinnbildlicht Stärke und Wachsamkeit, daher wurde seine Gestalt oft als Wappenelement verwendet. Laut Überlieferung ernährt sich ein Greif mit Vorliebe von Pferdefleisch und empfindet eine instinktive Abneigung gegen gierige Menschen. Daher muß sich jeder hüten, dessen Sucht nach Reichtum sein Leben bestimmt, denn auch er könnte bald das Rauschen der Greifenschwingen in der Luft vernehmen.
Greife sind Mischwesen aus Löwen und Adlern. Sie haben den Leib eines Löwen und den Oberkörper eines Adlers, samt Schwingen und Federn. Der Greif versinnbildlicht Stärke und Wachsamkeit, daher wurde seine Gestalt oft als Wappenelement verwendet. Laut Überlieferung ernährt sich ein Greif mit Vorliebe von Pferdefleisch und empfindet eine instinktive Abneigung gegen gierige Menschen. Daher muß sich jeder hüten, dessen Sucht nach Reichtum sein Leben bestimmt, denn auch er könnte bald das Rauschen der Greifenschwingen in der Luft vernehmen. 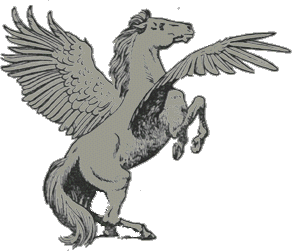 Pegasus ist der griechischen Sage nach ein geflügeltes Pferd, das aus dem Blut der Gorgone Medusa entstand. Als Perseus der Medusa den Kopf abschlug entsprangen ihrem kopflosen Körper zwei Kinder, die man ihrer Verbindung mit Poseidon zuschreibt. Bei einem der Kinder handelte es sich um den sagenhaften Pegasus. Viele Götter haben im Lauf der Zeit versucht Pegasus einzufangen. Keinem ist dies gelungen, bis Athene ein goldenes Zaumzeug mit Zauberkraft erschuf, mit dessen Hilfe der Prinz Bellerophon Pegasus einfangen konnte. Beide bekämpften danach erfolgreich das Ungeheuer von Lykien, die Chimäre. Später versuchte Bellerophon jedoch mit Hilfe von Pegasus in den Olymp zu gelangen. Aus Zorn darüber schickte Zeus ein Insekt, welches Pegasus stach. Dieser scheute daraufhin und warf Bellerophon ab. Pegasus wurde in den Stall des Olymp aufgenommen, um Zeus zu dienen, wärend Bellerophon als Ausgestoßener von nun an heimatlos durch die Welt irrte.
Pegasus ist der griechischen Sage nach ein geflügeltes Pferd, das aus dem Blut der Gorgone Medusa entstand. Als Perseus der Medusa den Kopf abschlug entsprangen ihrem kopflosen Körper zwei Kinder, die man ihrer Verbindung mit Poseidon zuschreibt. Bei einem der Kinder handelte es sich um den sagenhaften Pegasus. Viele Götter haben im Lauf der Zeit versucht Pegasus einzufangen. Keinem ist dies gelungen, bis Athene ein goldenes Zaumzeug mit Zauberkraft erschuf, mit dessen Hilfe der Prinz Bellerophon Pegasus einfangen konnte. Beide bekämpften danach erfolgreich das Ungeheuer von Lykien, die Chimäre. Später versuchte Bellerophon jedoch mit Hilfe von Pegasus in den Olymp zu gelangen. Aus Zorn darüber schickte Zeus ein Insekt, welches Pegasus stach. Dieser scheute daraufhin und warf Bellerophon ab. Pegasus wurde in den Stall des Olymp aufgenommen, um Zeus zu dienen, wärend Bellerophon als Ausgestoßener von nun an heimatlos durch die Welt irrte. 
 Stonehenge ist eine vorgeschichtliche Kultstätte in England, die im Sagenkreis eine große Bedeutung hat, da ihr starke magische Kräfte zugeschrieben werden. So verwundert es nicht, daß dieser Ort in Überlieferungen häufig als Zentrum religiöser Zeremonien benannt wird. Stonehenge besteht aus konzentrischen Steinkreisen, die von Vierkantblöcken gebildet werden, von denen ursprünglich jeweils zwei durch Querblöcke verbunden waren. Im Inneren befindet sich eine Anlage von Steinen, die hufeisenförmig angeordnet sind. In ihrer Mitte steht ein einzelner Steinblock, der Altarstein. Der Kreis wird nur von einem breiten Weg unterbrochen, der von einem Erdwall gesäumt wird, hierdurch gelangen Prozessionen in die Mitte des Steinkreises.
Stonehenge ist eine vorgeschichtliche Kultstätte in England, die im Sagenkreis eine große Bedeutung hat, da ihr starke magische Kräfte zugeschrieben werden. So verwundert es nicht, daß dieser Ort in Überlieferungen häufig als Zentrum religiöser Zeremonien benannt wird. Stonehenge besteht aus konzentrischen Steinkreisen, die von Vierkantblöcken gebildet werden, von denen ursprünglich jeweils zwei durch Querblöcke verbunden waren. Im Inneren befindet sich eine Anlage von Steinen, die hufeisenförmig angeordnet sind. In ihrer Mitte steht ein einzelner Steinblock, der Altarstein. Der Kreis wird nur von einem breiten Weg unterbrochen, der von einem Erdwall gesäumt wird, hierdurch gelangen Prozessionen in die Mitte des Steinkreises.
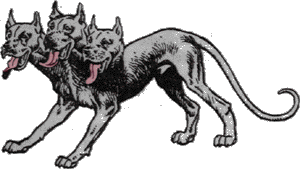 Zerberus (Kerberos) ist der Name des schrecklichen Höllenhundes, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Der Sage nach handelt es sich um ein gewaltiges hundeähnliches Geschöpf, daß jedoch drei Köpfe besitzt und jedes der drei Mäuler verfügt über schreckliche Reißzähne. Zerberus verwehrt jedem den Zutritt in die Unterwelt, der dort nicht hingehört und diejenigen, die an diesem Ort verbleiben müssen, läßt er nicht hinaus. Nur wenigen Helden ist es bisher gelungen, Zerberus auf die eine oder andere Art zu besänftigen oder kurzfristig zu überlisten. Denn der Herr der Unterwelt selbst hat das Ungeheuer mit besonderen Kräften ausgestattet, die es ihm erlauben auch den meisten Göttern zu widerstehen.
Zerberus (Kerberos) ist der Name des schrecklichen Höllenhundes, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Der Sage nach handelt es sich um ein gewaltiges hundeähnliches Geschöpf, daß jedoch drei Köpfe besitzt und jedes der drei Mäuler verfügt über schreckliche Reißzähne. Zerberus verwehrt jedem den Zutritt in die Unterwelt, der dort nicht hingehört und diejenigen, die an diesem Ort verbleiben müssen, läßt er nicht hinaus. Nur wenigen Helden ist es bisher gelungen, Zerberus auf die eine oder andere Art zu besänftigen oder kurzfristig zu überlisten. Denn der Herr der Unterwelt selbst hat das Ungeheuer mit besonderen Kräften ausgestattet, die es ihm erlauben auch den meisten Göttern zu widerstehen.